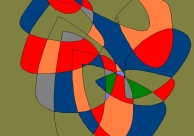Donnerstag, 12. Mai 2005
Macht Wissen klug?
moravagine, 13:41h
Wer kennt noch den alten Begriff elektronische Datenverarbeitung? Kaum jemand. Wer kann erklären, warum es nun Informationstechnologie heißt? Kaum jemand. Eigentlich niemand. Aber dass die Zunft der Software- und Hardwareexperten sich ständig um Wörter wie Daten und Information bewegt, dürfte klar sein. Seit der Terminus Knowledge Management etwas unglücklich mit Wissensmanagement ins Deutsche übersetzt wurde, ist auch das Wissen selbst zum Inhalt umfangreicher Marketingschlachten geworden. Dabei ist das Wissen an sich Gegenstand etlicher wissenschaftlicher Diskussionen, die in Deutschland leider sehr selten interdisziplinär geführt werden.
Brainstorming
Die Einen suchen mit bildgebenden Verfahren die Tätigkeit des Denkens im Gehirn zu verorten, andere erheben mit dem radikalen Konstruktivismus den Anspruch, das wissenschaftliche Gebäude zu erschüttern. Der Mathematiker und Psychologe Ernst von Glasersfeld verneint die Idee, dass Wissen von außen passiv aufgenommen wird – weder durch Kommunikation noch überhaupt durch Sinnesorgane. Er zeigt auf, dass Wissen ein aktives Aufbauen und Synthetisieren von Neuigkeiten mit altbewährten Überzeugungen ist, eine Wiederholung des Nützlichen mit dem Ziel, die Erfahrungswelt sinnvoll zu organisieren. Damit sind abstrakte Denkgebäude per se kein Wissen.
Spinnen die Philosophen?
Der Ansatz des radikalen Konstruktivismus ist mittlerweile weit verbreitet in den Geistes- und Sozialwissenschaften und wird leider in den Managementkaderschmieden wie überhaupt in der Betriebswirtschaftslehre elegant ausgeklammert. Kommen wir zurück auf etwas handfestere Aspekte der Diskussion:
Das Know-how als Ausdruck des praktisch erprobten Fachwissens steht dem Knowledge als Überbegriff für akademisch erworbene Kenntnisse gegenüber. Hier Praktiker - dort Akademiker. Der Unterschied könnte größer nicht sein: Denn der praxisorientierte – meist intuitiv arbeitende - Könner ist in der Lage, seine Fähigkeiten auch und gerade unter flexiblen Situationen erfolgreich einzusetzen. Der Akademiker muss sich erst einen neuen Horizont erarbeiten und sein Gedächtnis (er hat alles Wissen nur erlesen) mit neuen Ausgangspositionen in Abgleich bringen. Das kostet Zeit und erfordert eine enorme Flexibilität, um sich vom Erlernten zu entfernen. Der größte Unterschied besteht darin, dass der Könner über Verstehen verfügt, der akademisch geschulte Wissende über ein umfangreiches Gedächtnis. Wirkliche Genies aber arbeiten ganz anders. Der 21-jährige Starpianist Lang-Lang aus China saß als kleiner Junge an einem Klavier und hörte im Radio Beethovens 'Pour Elise'. Er konnte es sofort nachspielen. Seine Eltern waren so begeistert, dass sie alles stehen und liegen ließen und mit ihrem Sohn nach Shanghai zogen, um ihm dort die bestmögliche Ausbildung zukommen zu lassen. Aber finden sie mal einen Personalchef, der eine wirkliche Begabung unter allen Bewerbern auch herausfindet. Denn die zukünftigen Leistungsträger sind meistens nicht durch gute Zeugnisse oder eine konsistente Vita erkennbar. Es geht um ganz andere Qualitäten. Lang Lang: „Musik ist das natürlichste der Welt. Wenn man sich wirklich entspannt, kommt alles von alleine.“
Die zwei Arten des Wissens
Wir können zusammenfassen, dass eine rein rationale Theorie über das Wissen auf einige Probleme stößt. Dies läßt sich vor allem daran festmachen, dass es zwei Strukturen des uns bekannten Wissens zu geben scheint. Einmal die Struktur des so genannten propositionalen Wissens: Das bedeutet, dass es eine Art des Wissens gibt, die in Aussagen - also in Sätzen – auftritt. Zum zweiten scheint es etwas zu geben, dass wir als Hintergrund bezeichnen können. Ein Beispiel soll dies erläutern: Jemand haut mit einem Hammer Nägel in eine Wand. Dabei fokussiert er die linke Hand mit dem Nagel, um sich nicht den Daumen zu verletzen. Aber wer glaubt im Traum daran, es würde helfen, sich auf die Hand mit dem Hammer zu konzentrieren? Eigentlich sollte man doch annehmen, dass sie näher am Geschehen ist und direkten Einfluss auf die Flugbahn des Hammers hat? Diese Hand handelt also scheinbar autonom, wir können präziser sagen: Sie handelt intuitiv.
Hintergrund und Vordergrund
Und genau das ist der Hintergrund unseres akademischen Wissens. Gilbert Rylei gebührt die Ehre, dieses mysteriöse Phänomen rund um das Wissen und das Können entdeckt zu haben: Er unterscheidet dabei das knowing that und das knowing how. Parallel hat sich Mihaly Polanyi, ein berühmter Chemiker aus Ungarn, in seinem englischen Exil um diese Problematik bemüht und das heute weithin missverstandene Konzept des tacit knowledge entwickelt. Er versteht darunter eine Glaubenssystem, das - naiv-magisch wie in der Kinderwelt - eine Art geistigen Horizont bildet, unter dem alle weiteren, höheren mentalen Tätigkeiten eingeordnet werden. Der Philosoph Wittgenstein hat dies treffend so formuliert:“ Was feststeht, tut dies nicht, weil es an sich offenbar oder einleuchtend ist, sondern es wird von dem, was darum herum liegt, festgehalten (§144)“.
Mit Ryles Unterscheidung haben wir auch das Werkzeug in der Hand, um Polanyi endlich richtig zu verstehen, denn knowing-how ist nicht mit Wissen wie... zu übersetzen sondern es ist eine Bezeichnung für eine bestimmte, aktive entschiedene Praxis – das heißt, ich entscheide mich angesichts von vielen Möglichkeiten hier und jetzt für eine bestimmte Aktion. Diese Entscheidung geht immer dem Wissen voraus: Wir müssen es als decisive skill und damit als eine Entscheidungskompetenz angesichts von verschiedenen Alternativen bezeichnen. Polanyi hat dazu Befragungen gemacht: Er wollte von Schwimmern wissen, wie sie das machen. Alle Befragten hatten extreme Probleme, ihre Fähigkeit zu beschreiben und antworteten, dass es etwas mit Tempo und Muskelspannung zu tun hat. Die Aspekte des Auftriebs und die Atemtechnik – als wahre Gründe – wurden nicht genannt. Sie konnten also schwimmen, obwohl sie ein falsches Wissen vom Vorgang hatten!
Wir erinnern uns an die Olympiade 2004 als jeder deutsche Schwimmer, der gerade das Becken verlassen hatte nach dem Grund seines Scheiterns gefragt wurde und hilflos mit den Schultern zuckte. Der mehrfache Goldmedaillengewinner Michael Phelps hatte ein Erklärung, er meditiere vor dem Wettkampf und denke gerade nicht an all das, was er im Training gelernt hatte. In der Ruhe liegt die Kraft. Im Moment der Herausforderung kann das Besinnen auf alle Fähigkeiten schädlich sein.
Dieses „mehr wissen, als wir zu sagen imstande sind“ ist Ausgangspunkt von Polanyis tacit knowledge, das in Deutschland seltsamerweise mit implizitem oder stillem Wissen umschrieben wird. Der Fehler wird sofort offenbar, wenn man bedenkt, dass Wissen nach Polanyi eine zweigeteilte Struktur hat: Es gibt einen sehr körperlichen Teil des Wissens (Hintergrund), den wir nicht mitteilen können. Und es gibt einen Teil, der sehr wohl beschreibbar und damit mitteilbar ist (Wahrnehmungszentrum). Das heißt, tacit knowledge ist immer vorhanden. Es gibt gar kein explizites Wissen ohne tacit knowledge. Aus der Natur dieser spezifischen Vorform unseres akademischen Wissen leitet sich ab, dass wir sie gar nicht beschreiben können. Polanyi hat sie durch Experimente nachgewiesen und seine Gedanken zu diesen Experimenten zum Inhalt seiner Bücher gemacht. Aber er hat es nie beschrieben!
Wie setzt man das um?
Es gibt viele Aspekte rund um das Wissensmanagement, die neu bewertet werden müssen. Der erste ist: Es gibt gar keine Software, die mit nicht mitteilbarem Wissen umgehen könnte, denn das Agens, dass Software als kleinster Nenner zusammen hält, ist der Code. Ob es sich um einen Zeichencode, Sprache oder sonst etwas handelt – im geringsten ist es eben die 0 und die 1. Aber alles, was sich damit darstellen läßt, ist eine Momentaufnahme dessen, was in diesem Moment eher wahr als falsch ist. Wissensdatenbanken veralten also im Moment des Entstehens, sie kosten die Autoren viel Zeit. Und die Relevanz der Inhalte kann sich entscheidend ändern. Und zwar immer dann, wenn sich die Wirklichkeit ändert, was in jedem Moment der Fall ist.
Wirkliche Hilfe kann man geben, wenn das gespeicherte Wissen präzise und schnell abrufbar ist, wenn der Suchende auch noch genug über Kollegen erfahren würde, die ähnliche Suchbegriffe einzugeben pflegen. Es wäre also sinnvoll, mit solchen Systemen, wenn sie einmal da sind, ad-hoc neue sozial Netze zu spannen und zwar themenorientiert und darauf zu hoffen, dass die Mitarbeiter eine möglichst frei konfigurierbare Plattform erhalten, in deren Rahmen sie sich selbst ihre Wegmarken, bevorzugten Aufenthaltsorte und ihren Nutzen gestalten. So hatte Wissensmanagement in den Achtzigern bei Chevron auch mal angefangen: Als eine Plattform, die Mitarbeiter bis zu einem bestimmten Grad frei benutzen konnten, um die enormen Distanzen zwischen Niederlassungen und Zeitzonen zu überbrücken. Mehr kann Wissensmanagement nicht leisten. Aber auch nicht weniger.
Quellen:
Glasersfeld, Ernst v.: Die Wurzeln des "Radikalen" Konstruktivismus. In: Die Wirklichkeit des Konstruktivismus. Zur Auseinandersetzung um ein neues Paradigma. Hans Ruedi Fischer (Hrsg.). Heidelberg: Carl Auer Verlag 1995
Ryle, Gilbert: The Concept of Mind. Chicago/London. University of Chicago Press 1949
Wittgenstein, Ludwig: Über Gewißheit. Werkausgabe. Band 8. Frankfurt. Suhrkamp Verlag 1984
Brainstorming
Die Einen suchen mit bildgebenden Verfahren die Tätigkeit des Denkens im Gehirn zu verorten, andere erheben mit dem radikalen Konstruktivismus den Anspruch, das wissenschaftliche Gebäude zu erschüttern. Der Mathematiker und Psychologe Ernst von Glasersfeld verneint die Idee, dass Wissen von außen passiv aufgenommen wird – weder durch Kommunikation noch überhaupt durch Sinnesorgane. Er zeigt auf, dass Wissen ein aktives Aufbauen und Synthetisieren von Neuigkeiten mit altbewährten Überzeugungen ist, eine Wiederholung des Nützlichen mit dem Ziel, die Erfahrungswelt sinnvoll zu organisieren. Damit sind abstrakte Denkgebäude per se kein Wissen.
Spinnen die Philosophen?
Der Ansatz des radikalen Konstruktivismus ist mittlerweile weit verbreitet in den Geistes- und Sozialwissenschaften und wird leider in den Managementkaderschmieden wie überhaupt in der Betriebswirtschaftslehre elegant ausgeklammert. Kommen wir zurück auf etwas handfestere Aspekte der Diskussion:
Das Know-how als Ausdruck des praktisch erprobten Fachwissens steht dem Knowledge als Überbegriff für akademisch erworbene Kenntnisse gegenüber. Hier Praktiker - dort Akademiker. Der Unterschied könnte größer nicht sein: Denn der praxisorientierte – meist intuitiv arbeitende - Könner ist in der Lage, seine Fähigkeiten auch und gerade unter flexiblen Situationen erfolgreich einzusetzen. Der Akademiker muss sich erst einen neuen Horizont erarbeiten und sein Gedächtnis (er hat alles Wissen nur erlesen) mit neuen Ausgangspositionen in Abgleich bringen. Das kostet Zeit und erfordert eine enorme Flexibilität, um sich vom Erlernten zu entfernen. Der größte Unterschied besteht darin, dass der Könner über Verstehen verfügt, der akademisch geschulte Wissende über ein umfangreiches Gedächtnis. Wirkliche Genies aber arbeiten ganz anders. Der 21-jährige Starpianist Lang-Lang aus China saß als kleiner Junge an einem Klavier und hörte im Radio Beethovens 'Pour Elise'. Er konnte es sofort nachspielen. Seine Eltern waren so begeistert, dass sie alles stehen und liegen ließen und mit ihrem Sohn nach Shanghai zogen, um ihm dort die bestmögliche Ausbildung zukommen zu lassen. Aber finden sie mal einen Personalchef, der eine wirkliche Begabung unter allen Bewerbern auch herausfindet. Denn die zukünftigen Leistungsträger sind meistens nicht durch gute Zeugnisse oder eine konsistente Vita erkennbar. Es geht um ganz andere Qualitäten. Lang Lang: „Musik ist das natürlichste der Welt. Wenn man sich wirklich entspannt, kommt alles von alleine.“
Die zwei Arten des Wissens
Wir können zusammenfassen, dass eine rein rationale Theorie über das Wissen auf einige Probleme stößt. Dies läßt sich vor allem daran festmachen, dass es zwei Strukturen des uns bekannten Wissens zu geben scheint. Einmal die Struktur des so genannten propositionalen Wissens: Das bedeutet, dass es eine Art des Wissens gibt, die in Aussagen - also in Sätzen – auftritt. Zum zweiten scheint es etwas zu geben, dass wir als Hintergrund bezeichnen können. Ein Beispiel soll dies erläutern: Jemand haut mit einem Hammer Nägel in eine Wand. Dabei fokussiert er die linke Hand mit dem Nagel, um sich nicht den Daumen zu verletzen. Aber wer glaubt im Traum daran, es würde helfen, sich auf die Hand mit dem Hammer zu konzentrieren? Eigentlich sollte man doch annehmen, dass sie näher am Geschehen ist und direkten Einfluss auf die Flugbahn des Hammers hat? Diese Hand handelt also scheinbar autonom, wir können präziser sagen: Sie handelt intuitiv.
Hintergrund und Vordergrund
Und genau das ist der Hintergrund unseres akademischen Wissens. Gilbert Rylei gebührt die Ehre, dieses mysteriöse Phänomen rund um das Wissen und das Können entdeckt zu haben: Er unterscheidet dabei das knowing that und das knowing how. Parallel hat sich Mihaly Polanyi, ein berühmter Chemiker aus Ungarn, in seinem englischen Exil um diese Problematik bemüht und das heute weithin missverstandene Konzept des tacit knowledge entwickelt. Er versteht darunter eine Glaubenssystem, das - naiv-magisch wie in der Kinderwelt - eine Art geistigen Horizont bildet, unter dem alle weiteren, höheren mentalen Tätigkeiten eingeordnet werden. Der Philosoph Wittgenstein hat dies treffend so formuliert:“ Was feststeht, tut dies nicht, weil es an sich offenbar oder einleuchtend ist, sondern es wird von dem, was darum herum liegt, festgehalten (§144)“.
Mit Ryles Unterscheidung haben wir auch das Werkzeug in der Hand, um Polanyi endlich richtig zu verstehen, denn knowing-how ist nicht mit Wissen wie... zu übersetzen sondern es ist eine Bezeichnung für eine bestimmte, aktive entschiedene Praxis – das heißt, ich entscheide mich angesichts von vielen Möglichkeiten hier und jetzt für eine bestimmte Aktion. Diese Entscheidung geht immer dem Wissen voraus: Wir müssen es als decisive skill und damit als eine Entscheidungskompetenz angesichts von verschiedenen Alternativen bezeichnen. Polanyi hat dazu Befragungen gemacht: Er wollte von Schwimmern wissen, wie sie das machen. Alle Befragten hatten extreme Probleme, ihre Fähigkeit zu beschreiben und antworteten, dass es etwas mit Tempo und Muskelspannung zu tun hat. Die Aspekte des Auftriebs und die Atemtechnik – als wahre Gründe – wurden nicht genannt. Sie konnten also schwimmen, obwohl sie ein falsches Wissen vom Vorgang hatten!
Wir erinnern uns an die Olympiade 2004 als jeder deutsche Schwimmer, der gerade das Becken verlassen hatte nach dem Grund seines Scheiterns gefragt wurde und hilflos mit den Schultern zuckte. Der mehrfache Goldmedaillengewinner Michael Phelps hatte ein Erklärung, er meditiere vor dem Wettkampf und denke gerade nicht an all das, was er im Training gelernt hatte. In der Ruhe liegt die Kraft. Im Moment der Herausforderung kann das Besinnen auf alle Fähigkeiten schädlich sein.
Dieses „mehr wissen, als wir zu sagen imstande sind“ ist Ausgangspunkt von Polanyis tacit knowledge, das in Deutschland seltsamerweise mit implizitem oder stillem Wissen umschrieben wird. Der Fehler wird sofort offenbar, wenn man bedenkt, dass Wissen nach Polanyi eine zweigeteilte Struktur hat: Es gibt einen sehr körperlichen Teil des Wissens (Hintergrund), den wir nicht mitteilen können. Und es gibt einen Teil, der sehr wohl beschreibbar und damit mitteilbar ist (Wahrnehmungszentrum). Das heißt, tacit knowledge ist immer vorhanden. Es gibt gar kein explizites Wissen ohne tacit knowledge. Aus der Natur dieser spezifischen Vorform unseres akademischen Wissen leitet sich ab, dass wir sie gar nicht beschreiben können. Polanyi hat sie durch Experimente nachgewiesen und seine Gedanken zu diesen Experimenten zum Inhalt seiner Bücher gemacht. Aber er hat es nie beschrieben!
Wie setzt man das um?
Es gibt viele Aspekte rund um das Wissensmanagement, die neu bewertet werden müssen. Der erste ist: Es gibt gar keine Software, die mit nicht mitteilbarem Wissen umgehen könnte, denn das Agens, dass Software als kleinster Nenner zusammen hält, ist der Code. Ob es sich um einen Zeichencode, Sprache oder sonst etwas handelt – im geringsten ist es eben die 0 und die 1. Aber alles, was sich damit darstellen läßt, ist eine Momentaufnahme dessen, was in diesem Moment eher wahr als falsch ist. Wissensdatenbanken veralten also im Moment des Entstehens, sie kosten die Autoren viel Zeit. Und die Relevanz der Inhalte kann sich entscheidend ändern. Und zwar immer dann, wenn sich die Wirklichkeit ändert, was in jedem Moment der Fall ist.
Wirkliche Hilfe kann man geben, wenn das gespeicherte Wissen präzise und schnell abrufbar ist, wenn der Suchende auch noch genug über Kollegen erfahren würde, die ähnliche Suchbegriffe einzugeben pflegen. Es wäre also sinnvoll, mit solchen Systemen, wenn sie einmal da sind, ad-hoc neue sozial Netze zu spannen und zwar themenorientiert und darauf zu hoffen, dass die Mitarbeiter eine möglichst frei konfigurierbare Plattform erhalten, in deren Rahmen sie sich selbst ihre Wegmarken, bevorzugten Aufenthaltsorte und ihren Nutzen gestalten. So hatte Wissensmanagement in den Achtzigern bei Chevron auch mal angefangen: Als eine Plattform, die Mitarbeiter bis zu einem bestimmten Grad frei benutzen konnten, um die enormen Distanzen zwischen Niederlassungen und Zeitzonen zu überbrücken. Mehr kann Wissensmanagement nicht leisten. Aber auch nicht weniger.
Quellen:
Glasersfeld, Ernst v.: Die Wurzeln des "Radikalen" Konstruktivismus. In: Die Wirklichkeit des Konstruktivismus. Zur Auseinandersetzung um ein neues Paradigma. Hans Ruedi Fischer (Hrsg.). Heidelberg: Carl Auer Verlag 1995
Ryle, Gilbert: The Concept of Mind. Chicago/London. University of Chicago Press 1949
Wittgenstein, Ludwig: Über Gewißheit. Werkausgabe. Band 8. Frankfurt. Suhrkamp Verlag 1984
... comment