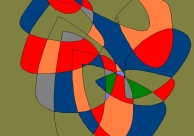... newer stories
Donnerstag, 12. Mai 2005
Macht Wissen klug?
moravagine, 13:41h
Wer kennt noch den alten Begriff elektronische Datenverarbeitung? Kaum jemand. Wer kann erklären, warum es nun Informationstechnologie heißt? Kaum jemand. Eigentlich niemand. Aber dass die Zunft der Software- und Hardwareexperten sich ständig um Wörter wie Daten und Information bewegt, dürfte klar sein. Seit der Terminus Knowledge Management etwas unglücklich mit Wissensmanagement ins Deutsche übersetzt wurde, ist auch das Wissen selbst zum Inhalt umfangreicher Marketingschlachten geworden. Dabei ist das Wissen an sich Gegenstand etlicher wissenschaftlicher Diskussionen, die in Deutschland leider sehr selten interdisziplinär geführt werden.
Brainstorming
Die Einen suchen mit bildgebenden Verfahren die Tätigkeit des Denkens im Gehirn zu verorten, andere erheben mit dem radikalen Konstruktivismus den Anspruch, das wissenschaftliche Gebäude zu erschüttern. Der Mathematiker und Psychologe Ernst von Glasersfeld verneint die Idee, dass Wissen von außen passiv aufgenommen wird – weder durch Kommunikation noch überhaupt durch Sinnesorgane. Er zeigt auf, dass Wissen ein aktives Aufbauen und Synthetisieren von Neuigkeiten mit altbewährten Überzeugungen ist, eine Wiederholung des Nützlichen mit dem Ziel, die Erfahrungswelt sinnvoll zu organisieren. Damit sind abstrakte Denkgebäude per se kein Wissen.
Spinnen die Philosophen?
Der Ansatz des radikalen Konstruktivismus ist mittlerweile weit verbreitet in den Geistes- und Sozialwissenschaften und wird leider in den Managementkaderschmieden wie überhaupt in der Betriebswirtschaftslehre elegant ausgeklammert. Kommen wir zurück auf etwas handfestere Aspekte der Diskussion:
Das Know-how als Ausdruck des praktisch erprobten Fachwissens steht dem Knowledge als Überbegriff für akademisch erworbene Kenntnisse gegenüber. Hier Praktiker - dort Akademiker. Der Unterschied könnte größer nicht sein: Denn der praxisorientierte – meist intuitiv arbeitende - Könner ist in der Lage, seine Fähigkeiten auch und gerade unter flexiblen Situationen erfolgreich einzusetzen. Der Akademiker muss sich erst einen neuen Horizont erarbeiten und sein Gedächtnis (er hat alles Wissen nur erlesen) mit neuen Ausgangspositionen in Abgleich bringen. Das kostet Zeit und erfordert eine enorme Flexibilität, um sich vom Erlernten zu entfernen. Der größte Unterschied besteht darin, dass der Könner über Verstehen verfügt, der akademisch geschulte Wissende über ein umfangreiches Gedächtnis. Wirkliche Genies aber arbeiten ganz anders. Der 21-jährige Starpianist Lang-Lang aus China saß als kleiner Junge an einem Klavier und hörte im Radio Beethovens 'Pour Elise'. Er konnte es sofort nachspielen. Seine Eltern waren so begeistert, dass sie alles stehen und liegen ließen und mit ihrem Sohn nach Shanghai zogen, um ihm dort die bestmögliche Ausbildung zukommen zu lassen. Aber finden sie mal einen Personalchef, der eine wirkliche Begabung unter allen Bewerbern auch herausfindet. Denn die zukünftigen Leistungsträger sind meistens nicht durch gute Zeugnisse oder eine konsistente Vita erkennbar. Es geht um ganz andere Qualitäten. Lang Lang: „Musik ist das natürlichste der Welt. Wenn man sich wirklich entspannt, kommt alles von alleine.“
Die zwei Arten des Wissens
Wir können zusammenfassen, dass eine rein rationale Theorie über das Wissen auf einige Probleme stößt. Dies läßt sich vor allem daran festmachen, dass es zwei Strukturen des uns bekannten Wissens zu geben scheint. Einmal die Struktur des so genannten propositionalen Wissens: Das bedeutet, dass es eine Art des Wissens gibt, die in Aussagen - also in Sätzen – auftritt. Zum zweiten scheint es etwas zu geben, dass wir als Hintergrund bezeichnen können. Ein Beispiel soll dies erläutern: Jemand haut mit einem Hammer Nägel in eine Wand. Dabei fokussiert er die linke Hand mit dem Nagel, um sich nicht den Daumen zu verletzen. Aber wer glaubt im Traum daran, es würde helfen, sich auf die Hand mit dem Hammer zu konzentrieren? Eigentlich sollte man doch annehmen, dass sie näher am Geschehen ist und direkten Einfluss auf die Flugbahn des Hammers hat? Diese Hand handelt also scheinbar autonom, wir können präziser sagen: Sie handelt intuitiv.
Hintergrund und Vordergrund
Und genau das ist der Hintergrund unseres akademischen Wissens. Gilbert Rylei gebührt die Ehre, dieses mysteriöse Phänomen rund um das Wissen und das Können entdeckt zu haben: Er unterscheidet dabei das knowing that und das knowing how. Parallel hat sich Mihaly Polanyi, ein berühmter Chemiker aus Ungarn, in seinem englischen Exil um diese Problematik bemüht und das heute weithin missverstandene Konzept des tacit knowledge entwickelt. Er versteht darunter eine Glaubenssystem, das - naiv-magisch wie in der Kinderwelt - eine Art geistigen Horizont bildet, unter dem alle weiteren, höheren mentalen Tätigkeiten eingeordnet werden. Der Philosoph Wittgenstein hat dies treffend so formuliert:“ Was feststeht, tut dies nicht, weil es an sich offenbar oder einleuchtend ist, sondern es wird von dem, was darum herum liegt, festgehalten (§144)“.
Mit Ryles Unterscheidung haben wir auch das Werkzeug in der Hand, um Polanyi endlich richtig zu verstehen, denn knowing-how ist nicht mit Wissen wie... zu übersetzen sondern es ist eine Bezeichnung für eine bestimmte, aktive entschiedene Praxis – das heißt, ich entscheide mich angesichts von vielen Möglichkeiten hier und jetzt für eine bestimmte Aktion. Diese Entscheidung geht immer dem Wissen voraus: Wir müssen es als decisive skill und damit als eine Entscheidungskompetenz angesichts von verschiedenen Alternativen bezeichnen. Polanyi hat dazu Befragungen gemacht: Er wollte von Schwimmern wissen, wie sie das machen. Alle Befragten hatten extreme Probleme, ihre Fähigkeit zu beschreiben und antworteten, dass es etwas mit Tempo und Muskelspannung zu tun hat. Die Aspekte des Auftriebs und die Atemtechnik – als wahre Gründe – wurden nicht genannt. Sie konnten also schwimmen, obwohl sie ein falsches Wissen vom Vorgang hatten!
Wir erinnern uns an die Olympiade 2004 als jeder deutsche Schwimmer, der gerade das Becken verlassen hatte nach dem Grund seines Scheiterns gefragt wurde und hilflos mit den Schultern zuckte. Der mehrfache Goldmedaillengewinner Michael Phelps hatte ein Erklärung, er meditiere vor dem Wettkampf und denke gerade nicht an all das, was er im Training gelernt hatte. In der Ruhe liegt die Kraft. Im Moment der Herausforderung kann das Besinnen auf alle Fähigkeiten schädlich sein.
Dieses „mehr wissen, als wir zu sagen imstande sind“ ist Ausgangspunkt von Polanyis tacit knowledge, das in Deutschland seltsamerweise mit implizitem oder stillem Wissen umschrieben wird. Der Fehler wird sofort offenbar, wenn man bedenkt, dass Wissen nach Polanyi eine zweigeteilte Struktur hat: Es gibt einen sehr körperlichen Teil des Wissens (Hintergrund), den wir nicht mitteilen können. Und es gibt einen Teil, der sehr wohl beschreibbar und damit mitteilbar ist (Wahrnehmungszentrum). Das heißt, tacit knowledge ist immer vorhanden. Es gibt gar kein explizites Wissen ohne tacit knowledge. Aus der Natur dieser spezifischen Vorform unseres akademischen Wissen leitet sich ab, dass wir sie gar nicht beschreiben können. Polanyi hat sie durch Experimente nachgewiesen und seine Gedanken zu diesen Experimenten zum Inhalt seiner Bücher gemacht. Aber er hat es nie beschrieben!
Wie setzt man das um?
Es gibt viele Aspekte rund um das Wissensmanagement, die neu bewertet werden müssen. Der erste ist: Es gibt gar keine Software, die mit nicht mitteilbarem Wissen umgehen könnte, denn das Agens, dass Software als kleinster Nenner zusammen hält, ist der Code. Ob es sich um einen Zeichencode, Sprache oder sonst etwas handelt – im geringsten ist es eben die 0 und die 1. Aber alles, was sich damit darstellen läßt, ist eine Momentaufnahme dessen, was in diesem Moment eher wahr als falsch ist. Wissensdatenbanken veralten also im Moment des Entstehens, sie kosten die Autoren viel Zeit. Und die Relevanz der Inhalte kann sich entscheidend ändern. Und zwar immer dann, wenn sich die Wirklichkeit ändert, was in jedem Moment der Fall ist.
Wirkliche Hilfe kann man geben, wenn das gespeicherte Wissen präzise und schnell abrufbar ist, wenn der Suchende auch noch genug über Kollegen erfahren würde, die ähnliche Suchbegriffe einzugeben pflegen. Es wäre also sinnvoll, mit solchen Systemen, wenn sie einmal da sind, ad-hoc neue sozial Netze zu spannen und zwar themenorientiert und darauf zu hoffen, dass die Mitarbeiter eine möglichst frei konfigurierbare Plattform erhalten, in deren Rahmen sie sich selbst ihre Wegmarken, bevorzugten Aufenthaltsorte und ihren Nutzen gestalten. So hatte Wissensmanagement in den Achtzigern bei Chevron auch mal angefangen: Als eine Plattform, die Mitarbeiter bis zu einem bestimmten Grad frei benutzen konnten, um die enormen Distanzen zwischen Niederlassungen und Zeitzonen zu überbrücken. Mehr kann Wissensmanagement nicht leisten. Aber auch nicht weniger.
Quellen:
Glasersfeld, Ernst v.: Die Wurzeln des "Radikalen" Konstruktivismus. In: Die Wirklichkeit des Konstruktivismus. Zur Auseinandersetzung um ein neues Paradigma. Hans Ruedi Fischer (Hrsg.). Heidelberg: Carl Auer Verlag 1995
Ryle, Gilbert: The Concept of Mind. Chicago/London. University of Chicago Press 1949
Wittgenstein, Ludwig: Über Gewißheit. Werkausgabe. Band 8. Frankfurt. Suhrkamp Verlag 1984
Brainstorming
Die Einen suchen mit bildgebenden Verfahren die Tätigkeit des Denkens im Gehirn zu verorten, andere erheben mit dem radikalen Konstruktivismus den Anspruch, das wissenschaftliche Gebäude zu erschüttern. Der Mathematiker und Psychologe Ernst von Glasersfeld verneint die Idee, dass Wissen von außen passiv aufgenommen wird – weder durch Kommunikation noch überhaupt durch Sinnesorgane. Er zeigt auf, dass Wissen ein aktives Aufbauen und Synthetisieren von Neuigkeiten mit altbewährten Überzeugungen ist, eine Wiederholung des Nützlichen mit dem Ziel, die Erfahrungswelt sinnvoll zu organisieren. Damit sind abstrakte Denkgebäude per se kein Wissen.
Spinnen die Philosophen?
Der Ansatz des radikalen Konstruktivismus ist mittlerweile weit verbreitet in den Geistes- und Sozialwissenschaften und wird leider in den Managementkaderschmieden wie überhaupt in der Betriebswirtschaftslehre elegant ausgeklammert. Kommen wir zurück auf etwas handfestere Aspekte der Diskussion:
Das Know-how als Ausdruck des praktisch erprobten Fachwissens steht dem Knowledge als Überbegriff für akademisch erworbene Kenntnisse gegenüber. Hier Praktiker - dort Akademiker. Der Unterschied könnte größer nicht sein: Denn der praxisorientierte – meist intuitiv arbeitende - Könner ist in der Lage, seine Fähigkeiten auch und gerade unter flexiblen Situationen erfolgreich einzusetzen. Der Akademiker muss sich erst einen neuen Horizont erarbeiten und sein Gedächtnis (er hat alles Wissen nur erlesen) mit neuen Ausgangspositionen in Abgleich bringen. Das kostet Zeit und erfordert eine enorme Flexibilität, um sich vom Erlernten zu entfernen. Der größte Unterschied besteht darin, dass der Könner über Verstehen verfügt, der akademisch geschulte Wissende über ein umfangreiches Gedächtnis. Wirkliche Genies aber arbeiten ganz anders. Der 21-jährige Starpianist Lang-Lang aus China saß als kleiner Junge an einem Klavier und hörte im Radio Beethovens 'Pour Elise'. Er konnte es sofort nachspielen. Seine Eltern waren so begeistert, dass sie alles stehen und liegen ließen und mit ihrem Sohn nach Shanghai zogen, um ihm dort die bestmögliche Ausbildung zukommen zu lassen. Aber finden sie mal einen Personalchef, der eine wirkliche Begabung unter allen Bewerbern auch herausfindet. Denn die zukünftigen Leistungsträger sind meistens nicht durch gute Zeugnisse oder eine konsistente Vita erkennbar. Es geht um ganz andere Qualitäten. Lang Lang: „Musik ist das natürlichste der Welt. Wenn man sich wirklich entspannt, kommt alles von alleine.“
Die zwei Arten des Wissens
Wir können zusammenfassen, dass eine rein rationale Theorie über das Wissen auf einige Probleme stößt. Dies läßt sich vor allem daran festmachen, dass es zwei Strukturen des uns bekannten Wissens zu geben scheint. Einmal die Struktur des so genannten propositionalen Wissens: Das bedeutet, dass es eine Art des Wissens gibt, die in Aussagen - also in Sätzen – auftritt. Zum zweiten scheint es etwas zu geben, dass wir als Hintergrund bezeichnen können. Ein Beispiel soll dies erläutern: Jemand haut mit einem Hammer Nägel in eine Wand. Dabei fokussiert er die linke Hand mit dem Nagel, um sich nicht den Daumen zu verletzen. Aber wer glaubt im Traum daran, es würde helfen, sich auf die Hand mit dem Hammer zu konzentrieren? Eigentlich sollte man doch annehmen, dass sie näher am Geschehen ist und direkten Einfluss auf die Flugbahn des Hammers hat? Diese Hand handelt also scheinbar autonom, wir können präziser sagen: Sie handelt intuitiv.
Hintergrund und Vordergrund
Und genau das ist der Hintergrund unseres akademischen Wissens. Gilbert Rylei gebührt die Ehre, dieses mysteriöse Phänomen rund um das Wissen und das Können entdeckt zu haben: Er unterscheidet dabei das knowing that und das knowing how. Parallel hat sich Mihaly Polanyi, ein berühmter Chemiker aus Ungarn, in seinem englischen Exil um diese Problematik bemüht und das heute weithin missverstandene Konzept des tacit knowledge entwickelt. Er versteht darunter eine Glaubenssystem, das - naiv-magisch wie in der Kinderwelt - eine Art geistigen Horizont bildet, unter dem alle weiteren, höheren mentalen Tätigkeiten eingeordnet werden. Der Philosoph Wittgenstein hat dies treffend so formuliert:“ Was feststeht, tut dies nicht, weil es an sich offenbar oder einleuchtend ist, sondern es wird von dem, was darum herum liegt, festgehalten (§144)“.
Mit Ryles Unterscheidung haben wir auch das Werkzeug in der Hand, um Polanyi endlich richtig zu verstehen, denn knowing-how ist nicht mit Wissen wie... zu übersetzen sondern es ist eine Bezeichnung für eine bestimmte, aktive entschiedene Praxis – das heißt, ich entscheide mich angesichts von vielen Möglichkeiten hier und jetzt für eine bestimmte Aktion. Diese Entscheidung geht immer dem Wissen voraus: Wir müssen es als decisive skill und damit als eine Entscheidungskompetenz angesichts von verschiedenen Alternativen bezeichnen. Polanyi hat dazu Befragungen gemacht: Er wollte von Schwimmern wissen, wie sie das machen. Alle Befragten hatten extreme Probleme, ihre Fähigkeit zu beschreiben und antworteten, dass es etwas mit Tempo und Muskelspannung zu tun hat. Die Aspekte des Auftriebs und die Atemtechnik – als wahre Gründe – wurden nicht genannt. Sie konnten also schwimmen, obwohl sie ein falsches Wissen vom Vorgang hatten!
Wir erinnern uns an die Olympiade 2004 als jeder deutsche Schwimmer, der gerade das Becken verlassen hatte nach dem Grund seines Scheiterns gefragt wurde und hilflos mit den Schultern zuckte. Der mehrfache Goldmedaillengewinner Michael Phelps hatte ein Erklärung, er meditiere vor dem Wettkampf und denke gerade nicht an all das, was er im Training gelernt hatte. In der Ruhe liegt die Kraft. Im Moment der Herausforderung kann das Besinnen auf alle Fähigkeiten schädlich sein.
Dieses „mehr wissen, als wir zu sagen imstande sind“ ist Ausgangspunkt von Polanyis tacit knowledge, das in Deutschland seltsamerweise mit implizitem oder stillem Wissen umschrieben wird. Der Fehler wird sofort offenbar, wenn man bedenkt, dass Wissen nach Polanyi eine zweigeteilte Struktur hat: Es gibt einen sehr körperlichen Teil des Wissens (Hintergrund), den wir nicht mitteilen können. Und es gibt einen Teil, der sehr wohl beschreibbar und damit mitteilbar ist (Wahrnehmungszentrum). Das heißt, tacit knowledge ist immer vorhanden. Es gibt gar kein explizites Wissen ohne tacit knowledge. Aus der Natur dieser spezifischen Vorform unseres akademischen Wissen leitet sich ab, dass wir sie gar nicht beschreiben können. Polanyi hat sie durch Experimente nachgewiesen und seine Gedanken zu diesen Experimenten zum Inhalt seiner Bücher gemacht. Aber er hat es nie beschrieben!
Wie setzt man das um?
Es gibt viele Aspekte rund um das Wissensmanagement, die neu bewertet werden müssen. Der erste ist: Es gibt gar keine Software, die mit nicht mitteilbarem Wissen umgehen könnte, denn das Agens, dass Software als kleinster Nenner zusammen hält, ist der Code. Ob es sich um einen Zeichencode, Sprache oder sonst etwas handelt – im geringsten ist es eben die 0 und die 1. Aber alles, was sich damit darstellen läßt, ist eine Momentaufnahme dessen, was in diesem Moment eher wahr als falsch ist. Wissensdatenbanken veralten also im Moment des Entstehens, sie kosten die Autoren viel Zeit. Und die Relevanz der Inhalte kann sich entscheidend ändern. Und zwar immer dann, wenn sich die Wirklichkeit ändert, was in jedem Moment der Fall ist.
Wirkliche Hilfe kann man geben, wenn das gespeicherte Wissen präzise und schnell abrufbar ist, wenn der Suchende auch noch genug über Kollegen erfahren würde, die ähnliche Suchbegriffe einzugeben pflegen. Es wäre also sinnvoll, mit solchen Systemen, wenn sie einmal da sind, ad-hoc neue sozial Netze zu spannen und zwar themenorientiert und darauf zu hoffen, dass die Mitarbeiter eine möglichst frei konfigurierbare Plattform erhalten, in deren Rahmen sie sich selbst ihre Wegmarken, bevorzugten Aufenthaltsorte und ihren Nutzen gestalten. So hatte Wissensmanagement in den Achtzigern bei Chevron auch mal angefangen: Als eine Plattform, die Mitarbeiter bis zu einem bestimmten Grad frei benutzen konnten, um die enormen Distanzen zwischen Niederlassungen und Zeitzonen zu überbrücken. Mehr kann Wissensmanagement nicht leisten. Aber auch nicht weniger.
Quellen:
Glasersfeld, Ernst v.: Die Wurzeln des "Radikalen" Konstruktivismus. In: Die Wirklichkeit des Konstruktivismus. Zur Auseinandersetzung um ein neues Paradigma. Hans Ruedi Fischer (Hrsg.). Heidelberg: Carl Auer Verlag 1995
Ryle, Gilbert: The Concept of Mind. Chicago/London. University of Chicago Press 1949
Wittgenstein, Ludwig: Über Gewißheit. Werkausgabe. Band 8. Frankfurt. Suhrkamp Verlag 1984
... link (0 Kommentare) ... comment
p0es1s: Sind Computerviren Teil der Netzliteratur?
moravagine, 13:28h
Folgendes Interview hatte ich vor fünf Jahren geführt. Ich denke, zu Zeiten von Weblogs ist es wieder passend. Denn obwohl es Weblogs gibt und die ehemalige Netzliteratur damit sachlicher geworden ist, ist es ein doch ein Stück Kultur...
Eine Internationale Ausstellung zur digitale Poesie in Kassel
Manchmal erfordert ein neues Jahrtausend auch ein neues Paradigma. In Kassel gelingt digitaler Literatur offenbar die Alpenüberquerung zwischen Gutenberg und dem Informationszeitalter. Unbemerkt vom stillen Getöse der Poesie und Prosa auf der EXPO in Hannover hat in Kassel ein Stück Mensch-Kultur-Technik eine neue Lesart von Literatur etabliert. Dort findet noch bis zum 12.11.2000 eine Ausstellung zur digitalen Poesie statt. Bereits seit 1992 arbeiten die Kuratoren A. Vallias und F. W. Block zusammen an der Umsetzung ihrer Projektidee. p0es1s ist der Name eines virtuellen Orts für internationale Poesie im Bereich von Multimedia und Internet.
Unbemerkt vom stillen Getöse der Poesie und Prosa auf der EXPO in Hannover hat in Kassel ein Stück Mensch-Kultur-Technik eine neue Lesart von Literatur etabliert. Dort findet noch bis zum 12.11.2000 eine Ausstellung zur digitalen Poesie statt. Bereits seit 1992 arbeiten die Kuratoren A. Vallias und F. W. Block zusammen an der Umsetzung ihrer Projektidee. p0es1s ist der Name eines virtuellen Orts für internationale Poesie im Bereich von Multimedia und Internet.
Die Beiträge führen vor, wie Dichtkunst um hypermediale Möglichkeiten erweitert wird: Hybrid-Texte zwischen Schrift, Bild und Klang, die ausschließlich elektronisch produziert, gespeichert, verbreitet und rezipiert werden können. Es handelt sich hier um Sprachkunst durch Programmierung, Multimedia, Animation, Interaktivität und Netzkommunikation: Poesie, 'poesis' im engsten Wortsinne: Erfahrungmachen, Probieren als ästhetische Selbstbeobachtung und -hervorbringung. Die ausgewählten Beispiele inszenieren Sprachgebrauch unter neuartigen medialen Bedingungen und schließen damit an die Tradition experimenteller und intermedialer Schreibweisen des 20. Jahrhunderts an.
Ein Interview mit Dr. Friedrich W. Block , Kurator aus Kassel, und Dr. Christiane Heibach vom Lehrstuhl für Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Erfurt über die Ausstellung sowie die Ablösung der Literatur und der Literaturwissenschaft vom Buch.
Was erlebt ein Zuschauer auf der Ausstellung in Kassel?
Friedrich Block: Wir haben bei der Auswahl einerseits auf eine möglichst dichte Gestaltung der mittels neuer Medientechnologie erzeugten Arbeiten geachtet, andererseits auf Vielseitigkeit - also nicht etwa nur im Fokus darauf, was hierzulande als "Netzliteratur" oder jenseits des Teiches als "Hyperfiction" bzw. "Hypertext" firmiert. Die Palette der Ausstellung reicht also von hypertextbasierter Literatur (z.B. Susanne Berkenhegers Hilfe! über hypermediale Projekte, die Bild, Text und Ton kombinieren (wie z.B. Simon Biggs' transformatives Werk "Mozaic", bei dem Text und Bild miteinander interagieren und sich unter Einfluss der Benutzeraktivität mit der Maus ständig verändern, oder Mark Amerikas PHON:E:ME und kooperative Netzliteratur, die durch die Zusammenarbeit vieler Autoren zustande kommt (u.a. Guido Grigats 23:40 bis zu Softwarekunst, die die Bedingungen des Mediums Computer reflektiert (wie der Discoder von Exonemo, mit dem der Quellcode von Webseiten zerstört werden kann. Bewusst haben wir dabei auch keine Grenze zu sprachbezogenen Projekten der Netz- und Medienkunst gezogen, wie sich dies z.B. an dem Beitrag des ASCII-Art-Ensembles zeigt, das Bild und Film in das alte alphanumerische ASCII-Format umcodiert.
Dabei ist der Besucher von "p0es1s" sofort und auf verschiedenste Weise in das Geschehen einbezogen: Man bleibt nicht mehr oder weniger distanzierter Betrachter und Leser, sondern muss direkt in das Geschehen eingreifen. Das betrifft sowohl einen Grossteil der Internetprojekte als auch die interaktive Installation "Bodybuilding" von Frank Fietzek oder Eduardo Kacs Holopoem "May be then, if only as" - in den letzten beiden Fällen gar unter Einsatz des ganzen Körpers. So ist eine interessante Facette der Dichtung mit den neuen Medien eine veränderte Inszenierung des Publikums bzw. der Rezeption , die in kognitiver, körperlicher und sozialer Hinsicht zu einem beobachtbaren Bestandteil des jeweiligen Projektes wird.
Im digitalen Zeitalter wird die Literatur handgreiflich? Was ist der Hintergrund dieser Entwicklung?
Christiane Heibach: Der Literaturbegriff ist in den Köpfen der meisten literaturinteressierten Menschen noch nachhaltig mit dem Medium Buch verknüpft. Die Ausstellung "p0es1s"macht deutlich, dass dies nicht notwendigerweise der Fall sein muss. Schon relativ früh entdeckten Künstler das Potential der elektronischen Medien auch für die Literatur. So ist in der Ausstellung mit Ernesto de Melo e Castro einer der Pioniere der digitalen Poesie vertreten, der schon Anfang der sechziger Jahre mit Video arbeitete, um die Buchstaben aus ihrer Fixierung zu lösen und in Kombination mit Farben, mit Ton und mit Bewegung ein kinästhetisches Rezeptionserlebnis beim Betrachter anzustreben. Auch die Stuttgarter Gruppe um Max Bense herum experimentierte schon in den 60er Jahren mit Computerlyrik.
Diese Tendenzen stehen noch stark unter dem Einfluss der konkreten Poesie, mit den 80er Jahren dann, als der Personal Computer auch für Privatpersonen erschwinglich wurde, und zu Beginn der 90er Jahre mit dem Aufkommen des Internet haben sich zahlreiche weitere Formen computerbasierter Literatur entwickelt, die ganz unterschiedliche Tendenzen sichtbar werden lassen. Die schon erwähnte Arbeit "Bodybuilding" von Frank Fietzek z.B. besteht aus einer Kraftmaschine, gekoppelt mit einem Monitor. Will der Ausstellungsbesucher nun etwas auf diesem Monitor sehen, so muss er die Gewichte bewegen, dann erscheinen Dialogfragmente erotischen und pornographischen Inhalts, die den Leser direkt "anmachen". Um aber weiterlesen zu können, muss er im wahrsten Sinne des Wortes Kraftakte vollbringen. Wird in dieser Installation also der Zuschauer körperlich in das Werk integriert, arbeiten viele Projekte nur mit dem Bildschirm und der Maus.
Frank Fietzeks "Bodybuilder"
Und was ist das Ziel der Kasseler Ausstellung?
Friedrich Block: Einerseits beabsichtigen wir, unseren - selbstverständlich äußerst subjektiven - Eindruck vom "state of the art" digitaler Poesie zu vermitteln, d.h. Tendenzen aufzuzeigen, die - technologiegeleitet - interessante Erweiterungen des Literatursystems versprechen. Dabei scheue ich allerdings eine Euphorie des Neuen. Nicht nur, weil ich selbst nicht behaupten möchte, hier lägen schon in jeder Hinsicht überzeugende und zeitgemäße Erzeugnisse gegenwärtiger Literatur vor. Sondern vor allem, weil ich diese Tendenzen vor der Tradition medienbezüglicher und experimenteller Dichtkunst des 20. Jahrhunderts sehe.
Vallias und ich kommen selbst aus dem Einzugsgebiet visueller bzw. intermedialer Poesie und haben hier unsere ästhetische Haltung entwickelt - das hat sich selbstverständlich auf die Zusammenstellung und natürlich auch die Präsentation ausgewirkt (eine Website und eine Ausstellung). Gerade deswegen war uns auch wichtig, Leute dabeizuhaben wie Augusto de Campos, der in den 50er Jahren die Konkrete Poesie mit erfunden hat, oder Ernesto de Melo e Castro, der seit den frühen 60ern die Speerspitze der portugiesischen experimentellen Poesie dargestellt. Übrigens gibt es schon so etwas wie eine eigene Traditionsbildung in Sachen "p0es1s": bereits 1992 zeigten wir die - möglicherweise allererste - Ausstellung internationaler digitaler Dichtkunst unter Beteiligung u.a. von Jim Rosenberg, E. Kac, A. de Campos und anderen, die auch jetzt wieder dabei sind. Nur war das damals hierzulande noch überhaupt kein Thema und wurde daher kaum beachtet.
Christiane Heibach:: Ich darf noch ergänzen: Aus meiner Sicht liegt der Fokus der beiden Kuratoren klar auf literarischen Formen, die nur mit und durch den Computer existieren können, also nicht mehr auf Papier gebannt werden können. Damit wird sicherlich auch die Absicht verfolgt, deutlich zu machen, dass der Literaturbegriff durch den Einsatz neuer Medien wesentlich erweitert muss. Einerseits stellen die veränderten Produktionsbedingungen die Frage nach den Abstraktionsstufen unterhalb dessen, was auf dem Bildschirm sichtbar wird, nämlich nach der Rolle von Programmierung und Quellcode, andererseits verschwimmt gerade im Internet die Grenze zwischen Produzent und Rezipient, da viele Projekte Aktivitäten des Nutzers verlangen, der ihnen erst dadurch Gestalt verleiht. Damit wird auch die Frage nach sozialen Dynamiken und nach der Rolle des technisch vermittelten Gesprächs (z.B. in virtuellen Welten) für die literarische Produktion relevant. Zum Dritten geht die Tendenz ganz klar in die Richtung, andere Zeichensysteme mit Text zu kombinieren, so dass Literatur nicht mehr nur buchstäblich, sondern durch Interdependenzen mit Ton, Bild, Animation und Interaktivität geschaffen wird.
Ist digitaler Literatur gleichberechtigt 'Digital' und 'Literatur' - ist sie eine Kunstform, die ohne PC und Internet niemals möglich wäre und deren Genese daher eher technischer Natur ist - oder werden nur alte literarische Weine aus neuen digitalen Schläuchen getrunken?
Christiane Heibach:: Ich persönlich würde zu der ersten Interpretation neigen, aber das ist keinesfalls kanonisch - wie kaum etwas in diesem Bereich bisher in irgendeiner Weise normativ festgelegt ist, schon gar nicht der Begriff "digitale Literatur". Es gibt - gerade im Bereich der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, die gerade erst begonnen hat - mehrere Sichtweisen auf computerbasierte literarische Formen sowie Literatur im Internet.
Relativ klar ist wohl, dass digitale Literatur nicht im luftleeren Raum entstanden ist, sondern tatsächlich auch Traditionslinien der Printliteratur fortsetzt. Die Arbeiten von Reinhard Döhl z.B. orientieren sich sehr stark an der konkreten Poesie, geben ihr aber neue Impulse durch Effekte, die nur durch Programmierung zu erreichen sind. Andere Formen, z.B. kooperative Schreibprojekte, können ebenfalls auf eine längere Tradition zurückblicken, ebenso computergenerierte Literatur, die - wie Florian Cramer in seinen Permutationen schön zeigt, z.T. auf die lange Tradition der kombinatorischen Dichtung zurückgreift. Dennoch glaube ich, dass computer- und netzbasierte Literatur einen ganz eigenen Charakter entwickeln wird, und dieser hängt mit der eminenten Abstraktionsebene ab, auf die diese Art von Literatur aufbaut.
Wir haben es hier - erstmals - mit Schichtungen von Symbolebenen zu tun, durch die das erzeugt wird, was der Betrachter am Bildschirm zu sehen bekommt. D.h. die Programmiersprachen und auch die Weblayoutsprache HTML werden einerseits zu Objekten künstlerischer Produktion, andererseits aber auch zu einem Thema der Literaturwissenschaft, wenn sie den in den letzten Jahrzehnten sehr ausgedehnten Textbegriff ansetzt. Dann muss sie auch die Programmiersprachen zu ihrer Zuständigkeit erklären. Dass ist bei weitem nicht soweit hergeholt, wie es jetzt klingen mag; nur ist das Bewusstsein der Geisteswissenschaften noch nicht so weit gediehen.
Von Seiten der Programmierer sieht das anders aus: So gibt es inzwischen eine Society for Aesthetics in Computing and Mathematics, die sich mit der Ästhetik von Algorithmen befasst, ebenso werden aber Programmiersprachen als Code inzwischen auch für die literarische Produktion fruchtbar gemacht, wie z.B. in den Pearl-Gedichten, die sowohl als Code als auch als ausführbares Programm ästhetischen und poetischen Charakter entwickeln.
Man müsste demnach z.B. auch - wie es Florian Cramer fordert - Computerviren zu den netzliterarischen Formen zählen, denn sie erzeugen Abweichungen von der Norm und verbreiten sich über die Vernetzung von Computern. Andererseits haben wir es aber auch mit einer Veränderung der traditionellen Zeichensysteme zu tun: Text kann nun einerseits stark mit Bild und Ton interagieren, und zwar - was bisher kaum möglich war - in dynamischer Form und andererseits kann durch Programmierung Text in Bild oder Ton bzw. vice versa verwandelt werden, so dass die relativ eindeutige Funktionalisierung von Zeichensystemen ins Fliessen gerät. Insofern würde ich sagen, dass wir zwar einerseits die Traditionslinien, auf denen digitale Literaturformen aufbauen, nicht aus den Augen verlieren dürfen, andererseits aber dürfen wir auch nicht blind sein für die - meiner Meinung nach - zweifellos neuen Formen literarischer Produktion, die sich aus der Benutzung von Computer und Internet ergeben.
Simon Biggs: "Mozaic"
Friedrich Block: Ich unterstütze die Auffassung, dass eine mögliche Gattungsbezeichnung "digitale Literatur" nur für eine sprachorientierte Kunst gelten sollte, die ausschließlich in digitalen Medien produziert, gespeichert, verbreitet und rezipiert werden kann. Nun wollte uns allerdings schon David Bolter glauben machen, dass die Moderne in den Hypermedien sozusagen angekommen sei und hier ihre eigentliche Realisierung finde. Aber dieser Ansatz taugt nur für eine technologische Trivialisierung der bislang entwickelten Schreibweisen. "Finnegans Wake" lässt sich keinesfalls in eine bessere, da hypermediale Form übersetzen.
Etwas anderes ist die Frage, wie bestimmte ästhetische Konzepte wie 'Offenheit', 'Prozessualität', 'Bewegung', 'Intermedialität', 'Publikumsaktivität', die die Produktions- und Rezeptionsästhetik der Dichtung seit langem bestimmen, in den Hypermedien ausgearbeitet werden. Hier gibt es interessante Entwicklungen. Schwierigkeiten habe ich allerdings auch mit der vielleicht doch etwas grob geschnittenen Gegenüberstellung von digitaler und 'Print'-Literatur. Das blendet einfach wesentliche poetische Errungenschaften der Vergangenheit aus, die schon längst über den Rand der Gutenberggalaxis drängen: Lautpoesie, Aktionen, statische und kinetische Textobjekte, zeichnerische bzw. handschriftliche Artikulationen, Video- und Filmgedichte - hier ist die Formensprache schon überaus differenziert und sind Fragen der Multimedialität und -linearität schon bis zur Erschöpfung (?) durchgespielt. Man schaue sich nur einmal die 1960 von Franz Mon herausgegebene poetologische (und viel zu wenig beachtete) Anthologie "movens" an und erfahre, was dort bereits über die sogenannte Printliteratur hinaus- und auf die dem Digitalen zugeschriebenen Qualitäten hinweist. Was man aber sicherlich feststellen kann: durch die Entwicklungen im Bereich digitaler Literatur gibt es ganz offensichtlich Impulse, die sowohl poetologisch als auch wissenschaftlich für frischen Wind sorgen.
Im Rahmen der Ausstellung fand ein wissenschaftliches Symposium zum Thema 'Ästhetik digitaler Literatur' statt, nach den vielen ökonomischen Versuchen diese Literaturform in Wettbewerben zu hypen, wird digitale Literatur jetzt endlich die notwendige wissenschaftliche Anerkennung zuteil, oder geht es um mehr?
Christiane Heibach: Zumindest innerhalb der etablierten deutschen Literaturwissenschaft ist das Thema digitale Literatur/Netzliteratur immer noch ein Außenseiterthema. Der zumeist angewandte Literaturbegriff, auf den die meisten Literaturwissenschaftler aufbauen, ist der printliterarische des fixierten Buchstabens. Hinzu kommt auch eine gewisse kanonische Arroganz, die - zumeist ziemlich vorschnell - der digitalen und Netzliteratur die poetische Qualität abspricht.
Daran haben bisher auch die Wettbewerbe nicht viel geändert - die ZEIT hat den Pegasus-Internet-Literaturwettbewerb sterben lassen und die anderen Wettbewerbe dümpeln eher am Rande der öffentlichen Aufmerksamkeit vor sich hin. Die Suche nach dem "Ulysses" der Netzliteratur, wie sie z.B. Hermann Rothermund betreibt, spricht für die immer noch vorhandene printliterarische Bindung Bände und deutet darauf hin, dass die ontologische Seite der Betrachtung, nämlich die Frage nach der Verfasstheit des Mediums, mit dem gearbeitet wird, völlig außer acht gelassen wird. Legt man nämlich diesen Ansatz zugrunde, wird deutlich, dass printliterarische Kategorien - wenn überhaupt - nur zu einem geringen Teil auf Computer- und Netzliteratur übertragen werden können.
Gleichzeitig aber geht es tatsächlich auch um mehr: Die Etablierung eines an zwei Universitäten, nämlich Erfurt und Kassel, verorteten, jährlich stattfindenden Forums zum Thema digitale Literatur hat zweifellos auch einen Demonstrationseffekt und ist damit quasi ein geisteswissenschaftliches Politikum. Eines ihrer wesentlichen Ziele ist es, die Verkrustungen des Denkens aufzubrechen, die sich - Dekonstruktion hin, Dekonstruktion her - dennoch in der Literaturwissenschaft festgesetzt haben. Es geht daher auch darum, die Aufmerksamkeit - nicht nur der Wissenschaftler, sondern auch der Öffentlichkeit - für ein Thema zu wecken, von dem die Literatur nur ein Teil ist.
An den neuen literarischen Formen, die sich mit und durch den Computer entwickeln, lässt sich nämlich eines sehr gut demonstrieren: Wir haben es generell mit einem grundlegenden Problem zu tun, nämlich der Ablösung des Leitmediums Buch durch das Leitmedium Computer (was nicht heißt, dass das Buch verschwindet, es gibt nur seine hegemoniale Stellung ab) und den damit einhergehenden gravierenden epistemologischen Veränderungen. Was die Geisteswissenschaften - und v.a. die Literaturwissenschaft - nun machen müssten, wäre, diese Bedingungen zu analysieren, unter denen diese Ablösung vonstatten geht und - ähnlich wie Michael Giesecke es für den Wechsel von der Manuskript- zur Buchdruckkultur gemacht hat - die Folgen aufzuzeigen.
Wir haben es derzeit mit der Formierung von zwei völlig verschiedenen Wahrnehmungssystemen zu tun, und die jetzt aufwachsenden Generationen werden sehr viel eher mit dem Computer konfrontiert als mit dem Buch. Die Brücke zwischen diesen beiden Epistemologien zu bauen, wäre meines Erachtens daher eine der großen - und zweifellos eminent gesellschaftsrelevanten - Aufgaben der Literaturwissenschaft. Genau darauf versuchen wir mit der Etablierung des Themas im institutionalisierten akademischen Kontext aufmerksam zu machen. Weitergedacht bedeutet das aber auch, dass die Fachgrenzen überschritten werden müssen, da wir es nicht nur mit einer Veränderung der Zeichensysteme, sondern auch der sozialen Strukturen und der Wahrnehmungsgewohnheiten zu tun haben, deren Analyse eine Einbeziehung der Sozialwissenschaften, der Psychologie und auch der Informatik erfordert.
Friedrich Block: Ich will nur soviel ergänzen: Ob wir es tatsächlich mit zwei völlig verschiedenen Wahrnehmungssystemen zu tun haben - diese Annahme sollte die Wissenschaft erst einmal überprüfen. Und zwar empirisch. Dazu ist man, ich stimme Christiane unbedingt zu, auf Interdisziplinarität und einen erweiterten Literaturbegriff angewiesen.
Digitale Literatur zwingt zu Beobachtungsperspektiven, die die 'Kunst der Interpretation' endgültig verabschieden. Nun steht die Materialität der Kommunikation schon seit längerem hoch im Kurs. Nur würde ich die Literaturwissenschaft auch ungern auf Medienmaterialität eingrenzen. Dazu mag eine Gattungsbezeichnung wie 'digitale Literatur' verlocken. Die Beobachtung von Wahrnehmungssystemen in der Kunst verlangt nach einem Wissenschaftskonzept, das Kunst bzw. Literatur als ein mehrdimensionales System entwirft, das nicht nur das Technische bzw. die Medialität der Werke berücksichtigt (aber immerhin!), sondern auch Akteure und ihre kognitiven Erfahrungsbereiche, Kommunikationsverfahren sowie Formationen kulturellen Wissens. Ein Schritt in diese Richtung ist unter anderem, dass die Foren in Kassel und Erfurt Wissenschaftler und Künstler gleichberechtigt zusammenbringen und weiterhin mit verschiedenen Formen der Präsentation und des Gesprächs experimentieren werden.
Die Ästhetik der Netzliteraten wird oft mit Vilem Flusser und Baudrillard in Beziehung gesetzt. Hat die Diskussion um Verflüssigung und Flüchtigkeit heute noch Belang? Was ist aus dem Fluch des Simulakrums geworden?
Christiane Heibach: Zunächst einmal würde ich sagen, dass es DIE Ästhetik der Netzliteraten eigentlich nicht gibt. Die Ziele und Wurzeln der verschiedenen Formen von Internetliteratur und auch von digitaler Literatur sind sehr unterschiedlich, ebenso sind es ihre Erscheinungsformen. Wir haben es mit einer sehr jungen Entwicklung zu tun, mit sehr divergenten Phänomenen.
Das Problem der meisten Medientheoretiker ist es, dass sie sich selten an dem orientieren, was in der Medienpraxis tatsächlich umgesetzt wird - und das hat oft recht wenig mit den theoretischen Postulaten der Philosophen zu tun. Vilém Flusser legt den Fokus in seiner Philosophie sehr stark auf das Dialogische und sieht in der Vernetzung von Computern eine Möglichkeit, die einkanaligen Medien (die Informationen breit streuen, aber die kommunikative Rückkopplung nicht beinhalten) in ihre Schranken zu weisen zugunsten des vernetzten Gesprächs. Dies ist eine visionäre Idee, die uns einen Leitfaden zur Verfügung stellen kann, in welche Richtung wir die derzeitige Entwicklung beeinflussen können. Auch aus seiner Betrachtung des Computers können gerade für die digitale Literatur und Netzliteratur Impulse kommen, denn er sagt sehr richtig, dass der Computer ein Medium der Oberfläche ist, d.h. er verlangt andere Wahrnehmungsformen als das Buch - und damit auch andere Darstellungsformen.
Die Flüchtigkeit, aber vor allem die Transformation von Zeichensystemen (und Flusser behauptet hier, dass wir vielmehr über Farben und Bilder kommunizieren werden, als über den alphanumerischen Code) ist dabei sicher eines der Hauptthemen, mit denen wir uns auseinander zu setzen haben: die Entwicklung neuer bedeutungsvermittelnder Systeme, die viel eher auf eine Neuformierung synästhetischer Kommunikation (wie sie bisher nur das Face-to-face-Gespräch leisten kann) abzielt. Doch gerade an diesem Punkt scheint mir McLuhan nach wie vor derjenige zu sein, von dem wir am meisten lernen können, denn er entwickelt eine "Ontologie der Sinne", d.h. er betrachtet die elektronischen Medien unter dem Aspekt, inwieweit und in welcher Form unser gesamtes Wahrnehmungspotential angesprochen werden kann.
Was Baudrillard betrifft, haben wir es mit einem Medientheoretiker zu tun, der wenig Impulse für den derzeitigen Wandel geben kann. Die Simulation ist ein Stichwort, das mir in bezug auf den Computer zu einfach gestrickt ist. Hier wird es weniger um Simulationen gehen, als um Welterzeugungen, die nicht mehr Repräsentationen unserer Umwelt darstellen. Ich glaube auch, dass die vernetzte Kommunikation genau das unterläuft, was Baudrillard vor allem den Massenmedien unterstellt: nämlich die Selbstinszenierung als einzigen Zweck, ohne weitergehende Ziele zu verfolgen. Diese Selbstinszenierung sehen wir natürlich im politischen Bereich, in dem in erster Linie medienwirksame Effekte erzeugt werden; aber so gesehen war Politik schon immer Simulation, d.h. sie macht prinzipiell nie die Ziele transparent, die sie eigentlich verfolgt.
Die Vernetzung hingegen erzeugt ein subversives Potential, das genau diese Tendenzen unterlaufen kann (wobei natürlich auch der Selbstinszenierung Raum gegeben wird), da der Grad der Einflussnahme größer wird. In dem Masse, in dem das Internet zur kommunikativen Plattform wird, zu der jeder (mit entsprechender Ausrüstung) Zugang hat, wird es auch möglich, Protestaktionen weltweit zu inszenieren und somit die Simulation durch vielfältigen Informationsfluss zu entlarven. Es wird für Staatsorgane damit zunehmend schwieriger, den Diskurs zu kontrollieren. Diese Aspekte lässt Baudrillard völlig außer acht, so wie er - gerade weil er sich nicht mit einer "Ontologie des Mediums" auseinandersetzt - niemals versucht, die Struktur der Medien, die er kritisiert, zu analysieren.
Insgesamt denke ich, dass wir als Wissenschaftler (die Künstler als Medienpraktiker tun dies ja längst schon) vielmehr von der Basis konkreter Analysen ausgehen müssen, also erst einmal das Feld dessen sondieren müssen, was beobachtbar ist, um von dort ausgehend an der Praxis orientierte Theorien zu entwickeln, die v.a. die Aufgabe haben, Leitlinien für die zukünftige Gestaltung des Medien- und Gesellschaftssystems zu geben. Wir stehen damit vor einer eminent ethischen Herausforderung.
Eine Internationale Ausstellung zur digitale Poesie in Kassel
Manchmal erfordert ein neues Jahrtausend auch ein neues Paradigma. In Kassel gelingt digitaler Literatur offenbar die Alpenüberquerung zwischen Gutenberg und dem Informationszeitalter.
 Unbemerkt vom stillen Getöse der Poesie und Prosa auf der EXPO in Hannover hat in Kassel ein Stück Mensch-Kultur-Technik eine neue Lesart von Literatur etabliert. Dort findet noch bis zum 12.11.2000 eine Ausstellung zur digitalen Poesie statt. Bereits seit 1992 arbeiten die Kuratoren A. Vallias und F. W. Block zusammen an der Umsetzung ihrer Projektidee. p0es1s ist der Name eines virtuellen Orts für internationale Poesie im Bereich von Multimedia und Internet.
Unbemerkt vom stillen Getöse der Poesie und Prosa auf der EXPO in Hannover hat in Kassel ein Stück Mensch-Kultur-Technik eine neue Lesart von Literatur etabliert. Dort findet noch bis zum 12.11.2000 eine Ausstellung zur digitalen Poesie statt. Bereits seit 1992 arbeiten die Kuratoren A. Vallias und F. W. Block zusammen an der Umsetzung ihrer Projektidee. p0es1s ist der Name eines virtuellen Orts für internationale Poesie im Bereich von Multimedia und Internet.
Die Beiträge führen vor, wie Dichtkunst um hypermediale Möglichkeiten erweitert wird: Hybrid-Texte zwischen Schrift, Bild und Klang, die ausschließlich elektronisch produziert, gespeichert, verbreitet und rezipiert werden können. Es handelt sich hier um Sprachkunst durch Programmierung, Multimedia, Animation, Interaktivität und Netzkommunikation: Poesie, 'poesis' im engsten Wortsinne: Erfahrungmachen, Probieren als ästhetische Selbstbeobachtung und -hervorbringung. Die ausgewählten Beispiele inszenieren Sprachgebrauch unter neuartigen medialen Bedingungen und schließen damit an die Tradition experimenteller und intermedialer Schreibweisen des 20. Jahrhunderts an.
Ein Interview mit Dr. Friedrich W. Block , Kurator aus Kassel, und Dr. Christiane Heibach vom Lehrstuhl für Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Erfurt über die Ausstellung sowie die Ablösung der Literatur und der Literaturwissenschaft vom Buch.
Was erlebt ein Zuschauer auf der Ausstellung in Kassel?
Friedrich Block: Wir haben bei der Auswahl einerseits auf eine möglichst dichte Gestaltung der mittels neuer Medientechnologie erzeugten Arbeiten geachtet, andererseits auf Vielseitigkeit - also nicht etwa nur im Fokus darauf, was hierzulande als "Netzliteratur" oder jenseits des Teiches als "Hyperfiction" bzw. "Hypertext" firmiert. Die Palette der Ausstellung reicht also von hypertextbasierter Literatur (z.B. Susanne Berkenhegers Hilfe! über hypermediale Projekte, die Bild, Text und Ton kombinieren (wie z.B. Simon Biggs' transformatives Werk "Mozaic", bei dem Text und Bild miteinander interagieren und sich unter Einfluss der Benutzeraktivität mit der Maus ständig verändern, oder Mark Amerikas PHON:E:ME und kooperative Netzliteratur, die durch die Zusammenarbeit vieler Autoren zustande kommt (u.a. Guido Grigats 23:40 bis zu Softwarekunst, die die Bedingungen des Mediums Computer reflektiert (wie der Discoder von Exonemo, mit dem der Quellcode von Webseiten zerstört werden kann. Bewusst haben wir dabei auch keine Grenze zu sprachbezogenen Projekten der Netz- und Medienkunst gezogen, wie sich dies z.B. an dem Beitrag des ASCII-Art-Ensembles zeigt, das Bild und Film in das alte alphanumerische ASCII-Format umcodiert.
Dabei ist der Besucher von "p0es1s" sofort und auf verschiedenste Weise in das Geschehen einbezogen: Man bleibt nicht mehr oder weniger distanzierter Betrachter und Leser, sondern muss direkt in das Geschehen eingreifen. Das betrifft sowohl einen Grossteil der Internetprojekte als auch die interaktive Installation "Bodybuilding" von Frank Fietzek oder Eduardo Kacs Holopoem "May be then, if only as" - in den letzten beiden Fällen gar unter Einsatz des ganzen Körpers. So ist eine interessante Facette der Dichtung mit den neuen Medien eine veränderte Inszenierung des Publikums bzw. der Rezeption , die in kognitiver, körperlicher und sozialer Hinsicht zu einem beobachtbaren Bestandteil des jeweiligen Projektes wird.
Im digitalen Zeitalter wird die Literatur handgreiflich? Was ist der Hintergrund dieser Entwicklung?
Christiane Heibach: Der Literaturbegriff ist in den Köpfen der meisten literaturinteressierten Menschen noch nachhaltig mit dem Medium Buch verknüpft. Die Ausstellung "p0es1s"macht deutlich, dass dies nicht notwendigerweise der Fall sein muss. Schon relativ früh entdeckten Künstler das Potential der elektronischen Medien auch für die Literatur. So ist in der Ausstellung mit Ernesto de Melo e Castro einer der Pioniere der digitalen Poesie vertreten, der schon Anfang der sechziger Jahre mit Video arbeitete, um die Buchstaben aus ihrer Fixierung zu lösen und in Kombination mit Farben, mit Ton und mit Bewegung ein kinästhetisches Rezeptionserlebnis beim Betrachter anzustreben. Auch die Stuttgarter Gruppe um Max Bense herum experimentierte schon in den 60er Jahren mit Computerlyrik.
Diese Tendenzen stehen noch stark unter dem Einfluss der konkreten Poesie, mit den 80er Jahren dann, als der Personal Computer auch für Privatpersonen erschwinglich wurde, und zu Beginn der 90er Jahre mit dem Aufkommen des Internet haben sich zahlreiche weitere Formen computerbasierter Literatur entwickelt, die ganz unterschiedliche Tendenzen sichtbar werden lassen. Die schon erwähnte Arbeit "Bodybuilding" von Frank Fietzek z.B. besteht aus einer Kraftmaschine, gekoppelt mit einem Monitor. Will der Ausstellungsbesucher nun etwas auf diesem Monitor sehen, so muss er die Gewichte bewegen, dann erscheinen Dialogfragmente erotischen und pornographischen Inhalts, die den Leser direkt "anmachen". Um aber weiterlesen zu können, muss er im wahrsten Sinne des Wortes Kraftakte vollbringen. Wird in dieser Installation also der Zuschauer körperlich in das Werk integriert, arbeiten viele Projekte nur mit dem Bildschirm und der Maus.
Frank Fietzeks "Bodybuilder"
Und was ist das Ziel der Kasseler Ausstellung?
Friedrich Block: Einerseits beabsichtigen wir, unseren - selbstverständlich äußerst subjektiven - Eindruck vom "state of the art" digitaler Poesie zu vermitteln, d.h. Tendenzen aufzuzeigen, die - technologiegeleitet - interessante Erweiterungen des Literatursystems versprechen. Dabei scheue ich allerdings eine Euphorie des Neuen. Nicht nur, weil ich selbst nicht behaupten möchte, hier lägen schon in jeder Hinsicht überzeugende und zeitgemäße Erzeugnisse gegenwärtiger Literatur vor. Sondern vor allem, weil ich diese Tendenzen vor der Tradition medienbezüglicher und experimenteller Dichtkunst des 20. Jahrhunderts sehe.
Vallias und ich kommen selbst aus dem Einzugsgebiet visueller bzw. intermedialer Poesie und haben hier unsere ästhetische Haltung entwickelt - das hat sich selbstverständlich auf die Zusammenstellung und natürlich auch die Präsentation ausgewirkt (eine Website und eine Ausstellung). Gerade deswegen war uns auch wichtig, Leute dabeizuhaben wie Augusto de Campos, der in den 50er Jahren die Konkrete Poesie mit erfunden hat, oder Ernesto de Melo e Castro, der seit den frühen 60ern die Speerspitze der portugiesischen experimentellen Poesie dargestellt. Übrigens gibt es schon so etwas wie eine eigene Traditionsbildung in Sachen "p0es1s": bereits 1992 zeigten wir die - möglicherweise allererste - Ausstellung internationaler digitaler Dichtkunst unter Beteiligung u.a. von Jim Rosenberg, E. Kac, A. de Campos und anderen, die auch jetzt wieder dabei sind. Nur war das damals hierzulande noch überhaupt kein Thema und wurde daher kaum beachtet.
Christiane Heibach:: Ich darf noch ergänzen: Aus meiner Sicht liegt der Fokus der beiden Kuratoren klar auf literarischen Formen, die nur mit und durch den Computer existieren können, also nicht mehr auf Papier gebannt werden können. Damit wird sicherlich auch die Absicht verfolgt, deutlich zu machen, dass der Literaturbegriff durch den Einsatz neuer Medien wesentlich erweitert muss. Einerseits stellen die veränderten Produktionsbedingungen die Frage nach den Abstraktionsstufen unterhalb dessen, was auf dem Bildschirm sichtbar wird, nämlich nach der Rolle von Programmierung und Quellcode, andererseits verschwimmt gerade im Internet die Grenze zwischen Produzent und Rezipient, da viele Projekte Aktivitäten des Nutzers verlangen, der ihnen erst dadurch Gestalt verleiht. Damit wird auch die Frage nach sozialen Dynamiken und nach der Rolle des technisch vermittelten Gesprächs (z.B. in virtuellen Welten) für die literarische Produktion relevant. Zum Dritten geht die Tendenz ganz klar in die Richtung, andere Zeichensysteme mit Text zu kombinieren, so dass Literatur nicht mehr nur buchstäblich, sondern durch Interdependenzen mit Ton, Bild, Animation und Interaktivität geschaffen wird.
Ist digitaler Literatur gleichberechtigt 'Digital' und 'Literatur' - ist sie eine Kunstform, die ohne PC und Internet niemals möglich wäre und deren Genese daher eher technischer Natur ist - oder werden nur alte literarische Weine aus neuen digitalen Schläuchen getrunken?
Christiane Heibach:: Ich persönlich würde zu der ersten Interpretation neigen, aber das ist keinesfalls kanonisch - wie kaum etwas in diesem Bereich bisher in irgendeiner Weise normativ festgelegt ist, schon gar nicht der Begriff "digitale Literatur". Es gibt - gerade im Bereich der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, die gerade erst begonnen hat - mehrere Sichtweisen auf computerbasierte literarische Formen sowie Literatur im Internet.
Relativ klar ist wohl, dass digitale Literatur nicht im luftleeren Raum entstanden ist, sondern tatsächlich auch Traditionslinien der Printliteratur fortsetzt. Die Arbeiten von Reinhard Döhl z.B. orientieren sich sehr stark an der konkreten Poesie, geben ihr aber neue Impulse durch Effekte, die nur durch Programmierung zu erreichen sind. Andere Formen, z.B. kooperative Schreibprojekte, können ebenfalls auf eine längere Tradition zurückblicken, ebenso computergenerierte Literatur, die - wie Florian Cramer in seinen Permutationen schön zeigt, z.T. auf die lange Tradition der kombinatorischen Dichtung zurückgreift. Dennoch glaube ich, dass computer- und netzbasierte Literatur einen ganz eigenen Charakter entwickeln wird, und dieser hängt mit der eminenten Abstraktionsebene ab, auf die diese Art von Literatur aufbaut.
Wir haben es hier - erstmals - mit Schichtungen von Symbolebenen zu tun, durch die das erzeugt wird, was der Betrachter am Bildschirm zu sehen bekommt. D.h. die Programmiersprachen und auch die Weblayoutsprache HTML werden einerseits zu Objekten künstlerischer Produktion, andererseits aber auch zu einem Thema der Literaturwissenschaft, wenn sie den in den letzten Jahrzehnten sehr ausgedehnten Textbegriff ansetzt. Dann muss sie auch die Programmiersprachen zu ihrer Zuständigkeit erklären. Dass ist bei weitem nicht soweit hergeholt, wie es jetzt klingen mag; nur ist das Bewusstsein der Geisteswissenschaften noch nicht so weit gediehen.
Von Seiten der Programmierer sieht das anders aus: So gibt es inzwischen eine Society for Aesthetics in Computing and Mathematics, die sich mit der Ästhetik von Algorithmen befasst, ebenso werden aber Programmiersprachen als Code inzwischen auch für die literarische Produktion fruchtbar gemacht, wie z.B. in den Pearl-Gedichten, die sowohl als Code als auch als ausführbares Programm ästhetischen und poetischen Charakter entwickeln.
Man müsste demnach z.B. auch - wie es Florian Cramer fordert - Computerviren zu den netzliterarischen Formen zählen, denn sie erzeugen Abweichungen von der Norm und verbreiten sich über die Vernetzung von Computern. Andererseits haben wir es aber auch mit einer Veränderung der traditionellen Zeichensysteme zu tun: Text kann nun einerseits stark mit Bild und Ton interagieren, und zwar - was bisher kaum möglich war - in dynamischer Form und andererseits kann durch Programmierung Text in Bild oder Ton bzw. vice versa verwandelt werden, so dass die relativ eindeutige Funktionalisierung von Zeichensystemen ins Fliessen gerät. Insofern würde ich sagen, dass wir zwar einerseits die Traditionslinien, auf denen digitale Literaturformen aufbauen, nicht aus den Augen verlieren dürfen, andererseits aber dürfen wir auch nicht blind sein für die - meiner Meinung nach - zweifellos neuen Formen literarischer Produktion, die sich aus der Benutzung von Computer und Internet ergeben.
Simon Biggs: "Mozaic"
Friedrich Block: Ich unterstütze die Auffassung, dass eine mögliche Gattungsbezeichnung "digitale Literatur" nur für eine sprachorientierte Kunst gelten sollte, die ausschließlich in digitalen Medien produziert, gespeichert, verbreitet und rezipiert werden kann. Nun wollte uns allerdings schon David Bolter glauben machen, dass die Moderne in den Hypermedien sozusagen angekommen sei und hier ihre eigentliche Realisierung finde. Aber dieser Ansatz taugt nur für eine technologische Trivialisierung der bislang entwickelten Schreibweisen. "Finnegans Wake" lässt sich keinesfalls in eine bessere, da hypermediale Form übersetzen.
Etwas anderes ist die Frage, wie bestimmte ästhetische Konzepte wie 'Offenheit', 'Prozessualität', 'Bewegung', 'Intermedialität', 'Publikumsaktivität', die die Produktions- und Rezeptionsästhetik der Dichtung seit langem bestimmen, in den Hypermedien ausgearbeitet werden. Hier gibt es interessante Entwicklungen. Schwierigkeiten habe ich allerdings auch mit der vielleicht doch etwas grob geschnittenen Gegenüberstellung von digitaler und 'Print'-Literatur. Das blendet einfach wesentliche poetische Errungenschaften der Vergangenheit aus, die schon längst über den Rand der Gutenberggalaxis drängen: Lautpoesie, Aktionen, statische und kinetische Textobjekte, zeichnerische bzw. handschriftliche Artikulationen, Video- und Filmgedichte - hier ist die Formensprache schon überaus differenziert und sind Fragen der Multimedialität und -linearität schon bis zur Erschöpfung (?) durchgespielt. Man schaue sich nur einmal die 1960 von Franz Mon herausgegebene poetologische (und viel zu wenig beachtete) Anthologie "movens" an und erfahre, was dort bereits über die sogenannte Printliteratur hinaus- und auf die dem Digitalen zugeschriebenen Qualitäten hinweist. Was man aber sicherlich feststellen kann: durch die Entwicklungen im Bereich digitaler Literatur gibt es ganz offensichtlich Impulse, die sowohl poetologisch als auch wissenschaftlich für frischen Wind sorgen.
Im Rahmen der Ausstellung fand ein wissenschaftliches Symposium zum Thema 'Ästhetik digitaler Literatur' statt, nach den vielen ökonomischen Versuchen diese Literaturform in Wettbewerben zu hypen, wird digitale Literatur jetzt endlich die notwendige wissenschaftliche Anerkennung zuteil, oder geht es um mehr?
Christiane Heibach: Zumindest innerhalb der etablierten deutschen Literaturwissenschaft ist das Thema digitale Literatur/Netzliteratur immer noch ein Außenseiterthema. Der zumeist angewandte Literaturbegriff, auf den die meisten Literaturwissenschaftler aufbauen, ist der printliterarische des fixierten Buchstabens. Hinzu kommt auch eine gewisse kanonische Arroganz, die - zumeist ziemlich vorschnell - der digitalen und Netzliteratur die poetische Qualität abspricht.
Daran haben bisher auch die Wettbewerbe nicht viel geändert - die ZEIT hat den Pegasus-Internet-Literaturwettbewerb sterben lassen und die anderen Wettbewerbe dümpeln eher am Rande der öffentlichen Aufmerksamkeit vor sich hin. Die Suche nach dem "Ulysses" der Netzliteratur, wie sie z.B. Hermann Rothermund betreibt, spricht für die immer noch vorhandene printliterarische Bindung Bände und deutet darauf hin, dass die ontologische Seite der Betrachtung, nämlich die Frage nach der Verfasstheit des Mediums, mit dem gearbeitet wird, völlig außer acht gelassen wird. Legt man nämlich diesen Ansatz zugrunde, wird deutlich, dass printliterarische Kategorien - wenn überhaupt - nur zu einem geringen Teil auf Computer- und Netzliteratur übertragen werden können.
Gleichzeitig aber geht es tatsächlich auch um mehr: Die Etablierung eines an zwei Universitäten, nämlich Erfurt und Kassel, verorteten, jährlich stattfindenden Forums zum Thema digitale Literatur hat zweifellos auch einen Demonstrationseffekt und ist damit quasi ein geisteswissenschaftliches Politikum. Eines ihrer wesentlichen Ziele ist es, die Verkrustungen des Denkens aufzubrechen, die sich - Dekonstruktion hin, Dekonstruktion her - dennoch in der Literaturwissenschaft festgesetzt haben. Es geht daher auch darum, die Aufmerksamkeit - nicht nur der Wissenschaftler, sondern auch der Öffentlichkeit - für ein Thema zu wecken, von dem die Literatur nur ein Teil ist.
An den neuen literarischen Formen, die sich mit und durch den Computer entwickeln, lässt sich nämlich eines sehr gut demonstrieren: Wir haben es generell mit einem grundlegenden Problem zu tun, nämlich der Ablösung des Leitmediums Buch durch das Leitmedium Computer (was nicht heißt, dass das Buch verschwindet, es gibt nur seine hegemoniale Stellung ab) und den damit einhergehenden gravierenden epistemologischen Veränderungen. Was die Geisteswissenschaften - und v.a. die Literaturwissenschaft - nun machen müssten, wäre, diese Bedingungen zu analysieren, unter denen diese Ablösung vonstatten geht und - ähnlich wie Michael Giesecke es für den Wechsel von der Manuskript- zur Buchdruckkultur gemacht hat - die Folgen aufzuzeigen.
Wir haben es derzeit mit der Formierung von zwei völlig verschiedenen Wahrnehmungssystemen zu tun, und die jetzt aufwachsenden Generationen werden sehr viel eher mit dem Computer konfrontiert als mit dem Buch. Die Brücke zwischen diesen beiden Epistemologien zu bauen, wäre meines Erachtens daher eine der großen - und zweifellos eminent gesellschaftsrelevanten - Aufgaben der Literaturwissenschaft. Genau darauf versuchen wir mit der Etablierung des Themas im institutionalisierten akademischen Kontext aufmerksam zu machen. Weitergedacht bedeutet das aber auch, dass die Fachgrenzen überschritten werden müssen, da wir es nicht nur mit einer Veränderung der Zeichensysteme, sondern auch der sozialen Strukturen und der Wahrnehmungsgewohnheiten zu tun haben, deren Analyse eine Einbeziehung der Sozialwissenschaften, der Psychologie und auch der Informatik erfordert.
Friedrich Block: Ich will nur soviel ergänzen: Ob wir es tatsächlich mit zwei völlig verschiedenen Wahrnehmungssystemen zu tun haben - diese Annahme sollte die Wissenschaft erst einmal überprüfen. Und zwar empirisch. Dazu ist man, ich stimme Christiane unbedingt zu, auf Interdisziplinarität und einen erweiterten Literaturbegriff angewiesen.
Digitale Literatur zwingt zu Beobachtungsperspektiven, die die 'Kunst der Interpretation' endgültig verabschieden. Nun steht die Materialität der Kommunikation schon seit längerem hoch im Kurs. Nur würde ich die Literaturwissenschaft auch ungern auf Medienmaterialität eingrenzen. Dazu mag eine Gattungsbezeichnung wie 'digitale Literatur' verlocken. Die Beobachtung von Wahrnehmungssystemen in der Kunst verlangt nach einem Wissenschaftskonzept, das Kunst bzw. Literatur als ein mehrdimensionales System entwirft, das nicht nur das Technische bzw. die Medialität der Werke berücksichtigt (aber immerhin!), sondern auch Akteure und ihre kognitiven Erfahrungsbereiche, Kommunikationsverfahren sowie Formationen kulturellen Wissens. Ein Schritt in diese Richtung ist unter anderem, dass die Foren in Kassel und Erfurt Wissenschaftler und Künstler gleichberechtigt zusammenbringen und weiterhin mit verschiedenen Formen der Präsentation und des Gesprächs experimentieren werden.
Die Ästhetik der Netzliteraten wird oft mit Vilem Flusser und Baudrillard in Beziehung gesetzt. Hat die Diskussion um Verflüssigung und Flüchtigkeit heute noch Belang? Was ist aus dem Fluch des Simulakrums geworden?
Christiane Heibach: Zunächst einmal würde ich sagen, dass es DIE Ästhetik der Netzliteraten eigentlich nicht gibt. Die Ziele und Wurzeln der verschiedenen Formen von Internetliteratur und auch von digitaler Literatur sind sehr unterschiedlich, ebenso sind es ihre Erscheinungsformen. Wir haben es mit einer sehr jungen Entwicklung zu tun, mit sehr divergenten Phänomenen.
Das Problem der meisten Medientheoretiker ist es, dass sie sich selten an dem orientieren, was in der Medienpraxis tatsächlich umgesetzt wird - und das hat oft recht wenig mit den theoretischen Postulaten der Philosophen zu tun. Vilém Flusser legt den Fokus in seiner Philosophie sehr stark auf das Dialogische und sieht in der Vernetzung von Computern eine Möglichkeit, die einkanaligen Medien (die Informationen breit streuen, aber die kommunikative Rückkopplung nicht beinhalten) in ihre Schranken zu weisen zugunsten des vernetzten Gesprächs. Dies ist eine visionäre Idee, die uns einen Leitfaden zur Verfügung stellen kann, in welche Richtung wir die derzeitige Entwicklung beeinflussen können. Auch aus seiner Betrachtung des Computers können gerade für die digitale Literatur und Netzliteratur Impulse kommen, denn er sagt sehr richtig, dass der Computer ein Medium der Oberfläche ist, d.h. er verlangt andere Wahrnehmungsformen als das Buch - und damit auch andere Darstellungsformen.
Die Flüchtigkeit, aber vor allem die Transformation von Zeichensystemen (und Flusser behauptet hier, dass wir vielmehr über Farben und Bilder kommunizieren werden, als über den alphanumerischen Code) ist dabei sicher eines der Hauptthemen, mit denen wir uns auseinander zu setzen haben: die Entwicklung neuer bedeutungsvermittelnder Systeme, die viel eher auf eine Neuformierung synästhetischer Kommunikation (wie sie bisher nur das Face-to-face-Gespräch leisten kann) abzielt. Doch gerade an diesem Punkt scheint mir McLuhan nach wie vor derjenige zu sein, von dem wir am meisten lernen können, denn er entwickelt eine "Ontologie der Sinne", d.h. er betrachtet die elektronischen Medien unter dem Aspekt, inwieweit und in welcher Form unser gesamtes Wahrnehmungspotential angesprochen werden kann.
Was Baudrillard betrifft, haben wir es mit einem Medientheoretiker zu tun, der wenig Impulse für den derzeitigen Wandel geben kann. Die Simulation ist ein Stichwort, das mir in bezug auf den Computer zu einfach gestrickt ist. Hier wird es weniger um Simulationen gehen, als um Welterzeugungen, die nicht mehr Repräsentationen unserer Umwelt darstellen. Ich glaube auch, dass die vernetzte Kommunikation genau das unterläuft, was Baudrillard vor allem den Massenmedien unterstellt: nämlich die Selbstinszenierung als einzigen Zweck, ohne weitergehende Ziele zu verfolgen. Diese Selbstinszenierung sehen wir natürlich im politischen Bereich, in dem in erster Linie medienwirksame Effekte erzeugt werden; aber so gesehen war Politik schon immer Simulation, d.h. sie macht prinzipiell nie die Ziele transparent, die sie eigentlich verfolgt.
Die Vernetzung hingegen erzeugt ein subversives Potential, das genau diese Tendenzen unterlaufen kann (wobei natürlich auch der Selbstinszenierung Raum gegeben wird), da der Grad der Einflussnahme größer wird. In dem Masse, in dem das Internet zur kommunikativen Plattform wird, zu der jeder (mit entsprechender Ausrüstung) Zugang hat, wird es auch möglich, Protestaktionen weltweit zu inszenieren und somit die Simulation durch vielfältigen Informationsfluss zu entlarven. Es wird für Staatsorgane damit zunehmend schwieriger, den Diskurs zu kontrollieren. Diese Aspekte lässt Baudrillard völlig außer acht, so wie er - gerade weil er sich nicht mit einer "Ontologie des Mediums" auseinandersetzt - niemals versucht, die Struktur der Medien, die er kritisiert, zu analysieren.
Insgesamt denke ich, dass wir als Wissenschaftler (die Künstler als Medienpraktiker tun dies ja längst schon) vielmehr von der Basis konkreter Analysen ausgehen müssen, also erst einmal das Feld dessen sondieren müssen, was beobachtbar ist, um von dort ausgehend an der Praxis orientierte Theorien zu entwickeln, die v.a. die Aufgabe haben, Leitlinien für die zukünftige Gestaltung des Medien- und Gesellschaftssystems zu geben. Wir stehen damit vor einer eminent ethischen Herausforderung.
... link (0 Kommentare) ... comment
Affenkunst
moravagine, 13:19h
 Congo wurde 1954 geboren. Im zarten Alter zwischen 2 und 4 Jahren malte er über 400 Bilder von denen 1957 einige auf einer Londoner Ausstellung Aufsehen erregten. Denn sie sind sehr gute abstrakte Bilder, mit einer klaren Bildaufteilung und viel Gefühl für Farben gestaltet.
Congo wurde 1954 geboren. Im zarten Alter zwischen 2 und 4 Jahren malte er über 400 Bilder von denen 1957 einige auf einer Londoner Ausstellung Aufsehen erregten. Denn sie sind sehr gute abstrakte Bilder, mit einer klaren Bildaufteilung und viel Gefühl für Farben gestaltet. Sogar Picasso erwarb ein Bild. Aber: Congo ist ein Schimpanse. Und deshalb ist die große Auktion in Londen nächste Woche eine Sensation. Denn Bilder von Tieren wurden noch nie versteigert.
Desmond Morris, der Verhaltensforscher, der Ende der 50er Affen hinsichtlich ihres Verständnisses für Symmetrie und Gestaltung studierte, konnte das Rätsel rund um unsere primären Antriebe zur Kreativität auch nicht lösen.
Seltsam an dieser Geschichte ist das Maß an Kreativität, das Wissenschaftler aufbringen, um anthropologische Grundfesten in das Reich der Humankultur einzuführen. Stellen wir uns vor, er hätte Grundkomponenten der kreativen Tätigkeit erkannt. Was hätte das für Folgen für die Pädagogik und die Didaktik gehabt. Es wäre noch immer uninteressant, was für eine Persönlichkeit ein Lehrer oder Erzieher hat, wenn er oder sie nur die Kenntnis von solchen wissenschaftlichen Experimenten und ihre meterlangen Deutungen in den Uni-bibliotheken runterbeten könnte.
Sollen wir wirklich so weitermachen und allen Menschen Fertigkeiten beibringen, indem sie die mentalen Exkremente von anderen wiederkäuen müssen, die oft nur geschrieben wurden, um dem Publikationszwang der Akademiker genüge zu leisten. Ist das nicht wahre Affenwissenschaft?
Naja, kein Wunder, wir sind ja auch Primaten. So gesehen ist es nur stringent, wenn wir jetzt auch Affenbilder versteigern. Vielleicht sollten wir Affenkot in Bioläden verkaufen als humanoiden Naturdünger. Bücherläden verdienen damit ja auch nicht schlecht.
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 11. Mai 2005
Das erste Computerspiel
moravagine, 20:26h
Es ist keine Frage: Brot und Spiele sind essenziell für die Entwicklung höherer Organismen.
Im digitalen Zeitalter ist aber nun offenbar Schluß mit lustig. In den USA und Kanada will man (oder hat schon) Minispiele wie Solitaire oder Minesweeper von den Büro-PCs vertreiben, weil die Mitarbeiter zuviel Zeit mit dem Spielen verbringen.
Ein kalifornischer Abgeordneter namens Leland Yee reiht Computerspiele in dieselbe Kategorie wie Pornos und Alkohol.
Das finde ich sehr treffend.
An der Nachfrage solcher Genußmittel kann man erkennen, wie zentral das Problem eingeschätzt wird. Stellen wir uns vor, eindimensionale, sinnentleerte und ohne Folgenabschätzung vorgetragene Gedanken würden einfach verboten. Die meisten Politiker, Experten und anderen Profilneurotiker müssten erst lange denken, bevor sie öffentliche Mitteilungen in Pressemitteilungen oder Interview hinein blasen. Das gäbe eine heilige Ruhe.
Ich bin dafür, dass alles, was uns Zeit und Nerven stiehlt und auf lange Sicht schädlich ist, verbannt wird. Die Frage ist nur, was machen wir mit den Tausenden arbeitslosen Medienschaffenden und ihren Zwillingen, den Politikern und Vorständen? Kann man die auch so einfach loswerden wie Schnapsflaschen und Softwarekartons.
 Ach ja, hier kann man übrigens das erste Computerspiel spielen, das lange vor PONG in den Sechzigern erstellt wurde. Natürlich im Weltraummillieu - was sonst interessiert abseitige Menschen. Gerade in den USA und gerade am MIT.
Ach ja, hier kann man übrigens das erste Computerspiel spielen, das lange vor PONG in den Sechzigern erstellt wurde. Natürlich im Weltraummillieu - was sonst interessiert abseitige Menschen. Gerade in den USA und gerade am MIT.
Pfui, Mr. Yee lassen sie uns zum Angriff blasen auf diesen Sündenpfuhl. Für eine reine Welt dank Clementine! Mit sauberen Gedanken und sauberen Zeitverschwendungen wie dem Warten auf das abgestürzte System, damit wir die Buchungen zum fünften mal eingeben können, mit dem Warten auf das Mitarbeiter-Portal, das mal wieder sehr viel Zeit braucht zum Laden der Portlets oder beim Durchsuchen der 2346 Ergebnisse der Intranetsuche. Wobei der aktuellste Treffer aus dem Jahr 1998 kommt.
Nein. Alle Time Bandits müssen weg und zwar radikal - ob Mensch oder Software. Wir müssen ja die Produktivität steigern. Denn glücklicherweise lehren die Ökonomen noch heute, dass die Nachfrage nie nachlässt; sie wandert nur in andere Märkte.
Zurzeit ist sie in Asien und bastelt dort ein Wirtschaftswunder nach dem anderen. Ich freue mich schon auf die ganzen Zeitverschwender, die dann auf uns zukommen, wenn deren Pensionsfonds auf Beutezug gehen. Das sind dann nicht solche Spielzeugfirmen wie unsere lieben Heuschrecken. Das werden wirkliche Mächte sein. Sie werden in dreißig Jahren die letzten 10 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland aus Effizienzgründen wegschicken - zum Saufen und Computerspielen.
Im digitalen Zeitalter ist aber nun offenbar Schluß mit lustig. In den USA und Kanada will man (oder hat schon) Minispiele wie Solitaire oder Minesweeper von den Büro-PCs vertreiben, weil die Mitarbeiter zuviel Zeit mit dem Spielen verbringen.
Ein kalifornischer Abgeordneter namens Leland Yee reiht Computerspiele in dieselbe Kategorie wie Pornos und Alkohol.
Das finde ich sehr treffend.
An der Nachfrage solcher Genußmittel kann man erkennen, wie zentral das Problem eingeschätzt wird. Stellen wir uns vor, eindimensionale, sinnentleerte und ohne Folgenabschätzung vorgetragene Gedanken würden einfach verboten. Die meisten Politiker, Experten und anderen Profilneurotiker müssten erst lange denken, bevor sie öffentliche Mitteilungen in Pressemitteilungen oder Interview hinein blasen. Das gäbe eine heilige Ruhe.
Ich bin dafür, dass alles, was uns Zeit und Nerven stiehlt und auf lange Sicht schädlich ist, verbannt wird. Die Frage ist nur, was machen wir mit den Tausenden arbeitslosen Medienschaffenden und ihren Zwillingen, den Politikern und Vorständen? Kann man die auch so einfach loswerden wie Schnapsflaschen und Softwarekartons.
 Ach ja, hier kann man übrigens das erste Computerspiel spielen, das lange vor PONG in den Sechzigern erstellt wurde. Natürlich im Weltraummillieu - was sonst interessiert abseitige Menschen. Gerade in den USA und gerade am MIT.
Ach ja, hier kann man übrigens das erste Computerspiel spielen, das lange vor PONG in den Sechzigern erstellt wurde. Natürlich im Weltraummillieu - was sonst interessiert abseitige Menschen. Gerade in den USA und gerade am MIT.Pfui, Mr. Yee lassen sie uns zum Angriff blasen auf diesen Sündenpfuhl. Für eine reine Welt dank Clementine! Mit sauberen Gedanken und sauberen Zeitverschwendungen wie dem Warten auf das abgestürzte System, damit wir die Buchungen zum fünften mal eingeben können, mit dem Warten auf das Mitarbeiter-Portal, das mal wieder sehr viel Zeit braucht zum Laden der Portlets oder beim Durchsuchen der 2346 Ergebnisse der Intranetsuche. Wobei der aktuellste Treffer aus dem Jahr 1998 kommt.
Nein. Alle Time Bandits müssen weg und zwar radikal - ob Mensch oder Software. Wir müssen ja die Produktivität steigern. Denn glücklicherweise lehren die Ökonomen noch heute, dass die Nachfrage nie nachlässt; sie wandert nur in andere Märkte.
Zurzeit ist sie in Asien und bastelt dort ein Wirtschaftswunder nach dem anderen. Ich freue mich schon auf die ganzen Zeitverschwender, die dann auf uns zukommen, wenn deren Pensionsfonds auf Beutezug gehen. Das sind dann nicht solche Spielzeugfirmen wie unsere lieben Heuschrecken. Das werden wirkliche Mächte sein. Sie werden in dreißig Jahren die letzten 10 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland aus Effizienzgründen wegschicken - zum Saufen und Computerspielen.
... link (0 Kommentare) ... comment
Was soll das denn? Hughtrain Manifesto
moravagine, 20:21h
Erschreckend und sehr humorvoll an diesem Paper über die spirituelle Erweckung im Marketing ist nicht, dass manche es ernst nehmen könnten.
Sie tun es bereits. Der Bedeutungshorizont wird wieder ganz weit. Nicht mehr so piefig individuell. Wer hat nicht mitansehen müssen, dass seit einigen Jahren diese magische Welt der Spiritisten aller fundamentalistischer Couleur (Christen, Muslime, Juden) sozusagen die gesellschaftliche Mitte repräsentieren wollen.
Gegenaufklärung! höre ich da schon die ersten beflissenen Objektivisten aus den Parkettplätzen gröhlen. Aber wenn wir weiterlesen, dann kommt eine dolle Aufzählung auf Seite 6. Nach dem emotionalen Kapital käme das Expressive Kapital, also der Mehrwert des Mitessers an pickeliger Wange.
Liebe Kinder und Kinderinnen,
lasst es bitte nicht soweit kommen. Ich habe den Verdacht, dass man in einigen Gedankenstübchen - ähnlich den 60er,70er,80er und 90er Shows - eine Comebackshow dessen durchdekliniert, was wir so alles im Abitur, im Studium, in der kurzen Geschichte der Pseudowissenschaften an Bestsellern kennenlernen mussten. Die Hoffnung besteht dann wohl darin die bunten Realitätsförmchen durch die drei- und viereckigen Löcher zu frimeln. Und wenn alle drin sind, lacht das Kind, die Mutter öffnet die Klappe, und das Spiel geht von vorne los.
Kryptonite ist überall. Nicht nur in Marketingetagen! Schauen wir uns doch den Markt der politischen oder sachlichen Expertenmeinungen in den Medien an. Gibt es dort eine Ebene die erkennt, dass vieles Geschreibsel nur Tragegurte für halbseidene und kaum durchdachte Ideen der Menschen sind, die wir eigentlich bezahlen, damit sie unsere Zukunft öffnen, indem sie eine notwendig offene Gegenwart beschützen?
Aber was wäre, wenn man der Kaste der Entscheidungsträger die globale Aufgabe gäbe, vor allem breite Wahlmöglichkeiten im Handeln zu ermöglichen. Das wäre natürlich wenig spiritistisch. Es würde gesellschaftlicher Raum entstehen. Mehr nicht. Aber auch nicht weniger.
Dass Medien aber nichts zu imitieren hätten, kann man bezweifeln. Fängt doch der deutsche Verlegerverband an, analog zu den Kirchen bei Einstellungsgesprächen die Gesinnung prüfen zu wollen. Damit wären wir wieder bei der seltsamen Schleife zwischen Medien und Kirche vom Anfang. Aber damit ermöglichen sie sich wirklich die schlechten Manieren, die ihren zurzeit nur herbeigeredeten Abschwung (Tarifverhandlungen!) real beschleunigen könnten.
"A bad carpenter blames his tools"
Ich bin gespannt, welche shiny, new tools demnächst auf uns zurollen. Der PC ist es nicht mehr. IPod wird auch bald als dröger Walkman mit denselben leeren Batterien durchschaut. Wieviel Abspielgeräte kann ein Westeuropäer pro Kopf vertragen, ohne einen Bildschirm-, Ohren-,Tastenkoller zu bekommen?
Ich schätze 57 bei den Männern. Bei Frauen bin ich mir nicht sicher, wenn es in Schuhe eingebaut, ist dann sicher 345!
Cheers!
Sie tun es bereits. Der Bedeutungshorizont wird wieder ganz weit. Nicht mehr so piefig individuell. Wer hat nicht mitansehen müssen, dass seit einigen Jahren diese magische Welt der Spiritisten aller fundamentalistischer Couleur (Christen, Muslime, Juden) sozusagen die gesellschaftliche Mitte repräsentieren wollen.
Gegenaufklärung! höre ich da schon die ersten beflissenen Objektivisten aus den Parkettplätzen gröhlen. Aber wenn wir weiterlesen, dann kommt eine dolle Aufzählung auf Seite 6. Nach dem emotionalen Kapital käme das Expressive Kapital, also der Mehrwert des Mitessers an pickeliger Wange.
Liebe Kinder und Kinderinnen,
lasst es bitte nicht soweit kommen. Ich habe den Verdacht, dass man in einigen Gedankenstübchen - ähnlich den 60er,70er,80er und 90er Shows - eine Comebackshow dessen durchdekliniert, was wir so alles im Abitur, im Studium, in der kurzen Geschichte der Pseudowissenschaften an Bestsellern kennenlernen mussten. Die Hoffnung besteht dann wohl darin die bunten Realitätsförmchen durch die drei- und viereckigen Löcher zu frimeln. Und wenn alle drin sind, lacht das Kind, die Mutter öffnet die Klappe, und das Spiel geht von vorne los.
Kryptonite ist überall. Nicht nur in Marketingetagen! Schauen wir uns doch den Markt der politischen oder sachlichen Expertenmeinungen in den Medien an. Gibt es dort eine Ebene die erkennt, dass vieles Geschreibsel nur Tragegurte für halbseidene und kaum durchdachte Ideen der Menschen sind, die wir eigentlich bezahlen, damit sie unsere Zukunft öffnen, indem sie eine notwendig offene Gegenwart beschützen?
Aber was wäre, wenn man der Kaste der Entscheidungsträger die globale Aufgabe gäbe, vor allem breite Wahlmöglichkeiten im Handeln zu ermöglichen. Das wäre natürlich wenig spiritistisch. Es würde gesellschaftlicher Raum entstehen. Mehr nicht. Aber auch nicht weniger.
Dass Medien aber nichts zu imitieren hätten, kann man bezweifeln. Fängt doch der deutsche Verlegerverband an, analog zu den Kirchen bei Einstellungsgesprächen die Gesinnung prüfen zu wollen. Damit wären wir wieder bei der seltsamen Schleife zwischen Medien und Kirche vom Anfang. Aber damit ermöglichen sie sich wirklich die schlechten Manieren, die ihren zurzeit nur herbeigeredeten Abschwung (Tarifverhandlungen!) real beschleunigen könnten.
"A bad carpenter blames his tools"
Ich bin gespannt, welche shiny, new tools demnächst auf uns zurollen. Der PC ist es nicht mehr. IPod wird auch bald als dröger Walkman mit denselben leeren Batterien durchschaut. Wieviel Abspielgeräte kann ein Westeuropäer pro Kopf vertragen, ohne einen Bildschirm-, Ohren-,Tastenkoller zu bekommen?
Ich schätze 57 bei den Männern. Bei Frauen bin ich mir nicht sicher, wenn es in Schuhe eingebaut, ist dann sicher 345!
Cheers!
... link (0 Kommentare) ... comment